Morbus Stargardt ist eine seltene Augenerkrankung, die schon bei Kindern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen auftritt. Es handelt sich um eine erblich bedingte Störung der Netzhaut, insbesondere der Makula. Die Makula ist der Bereich im Zentrum der Netzhaut, mit dem wir Gesichter erkennen, Texte lesen und Farben unterscheiden können. Wird sie geschädigt, verschwimmt das zentrale Sehen allmählich. Betroffene erblinden nicht vollständig, aber die Sehschärfe nimmt spürbar ab, was den Alltag stark beeinflusst.
Ursachen
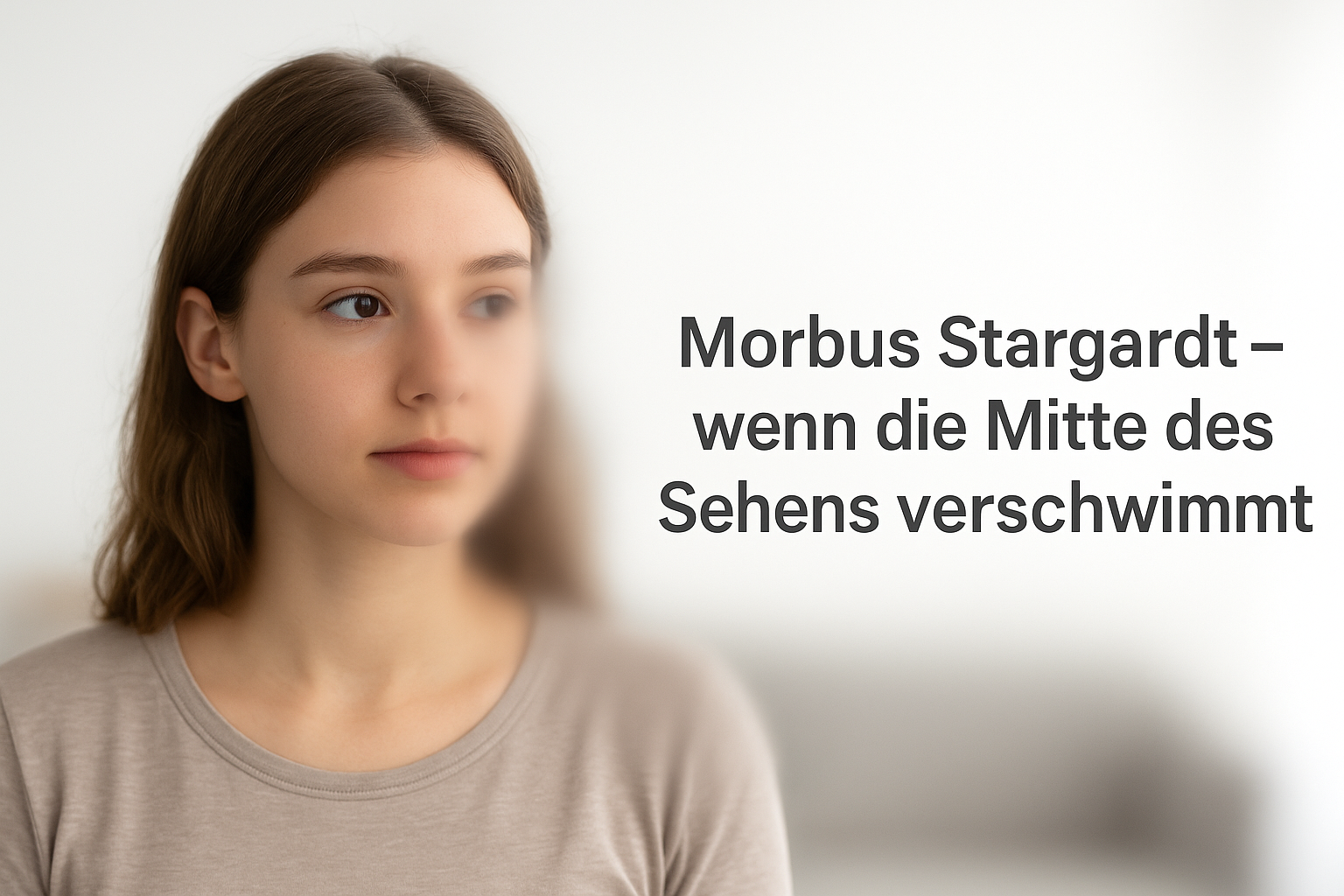
Die Erkrankung entsteht durch Veränderungen im ABCA4-Gen. Gene sind Baupläne unseres Körpers. Das ABCA4-Gen sorgt dafür, dass Abfallstoffe in den Sehzellen der Netzhaut abgebaut werden. Wenn dieses Gen defekt ist, lagern sich Lipofuszin (Abfallprodukte) in den Zellen ab. Man kann sich das wie kleine „Müllhalden“ vorstellen, die die empfindlichen Zellen schädigen.
Morbus Stargardt wird autosomal-rezessiv vererbt. Das bedeutet, dass beide Eltern ein verändertes Gen tragen müssen, damit ein Kind erkrankt. Eltern selbst sind dabei meist gesund, können die Erkrankung aber weitergeben.
Symptome
Die ersten Anzeichen treten häufig schon im Kindes- oder Jugendalter auf. Typisch sind:
- Verschwommenes Sehen in der Mitte: Gesichter und Texte verschwimmen oder sind schwerer zu erkennen.
- Abnahme der Sehschärfe: Details wie Straßenschilder oder Buchstaben sind schlechter zu erkennen.
- Blendempfindlichkeit: Sonnenlicht oder helle Lampen sind unangenehm.
- Farbsehstörungen: Feinere Farbunterschiede, etwa zwischen Rot und Braun, werden schwieriger.
- Seitliches Sehen bleibt erhalten: Orientierung und Bewegungserkennung sind weiterhin möglich.
Diagnose
Die Diagnose wird von einem Augenarzt mit verschiedenen Methoden gestellt:
- Augenspiegelung (Ophthalmoskopie): Sichtbare gelbliche Flecken auf der Netzhaut, verursacht durch Lipofuszin.
- Optische Kohärenztomographie (OCT): Ein bildgebendes Verfahren, das die Schichten der Netzhaut sichtbar macht.
- Elektroretinogramm (ERG): Misst die elektrische Aktivität der Netzhautzellen, ähnlich wie ein EKG beim Herzen.
- Genetischer Test: Bestätigt die Mutation im ABCA4-Gen.
Verlauf
Morbus Stargardt schreitet langsam, aber kontinuierlich fort. Die Sehschärfe verschlechtert sich über Jahre hinweg. Manche Betroffene sind schon als junge Erwachsene stark sehbehindert, andere erst später. Eine vollständige Erblindung im Sinne von „alles schwarz sehen“ tritt in der Regel nicht ein, da das seitliche Sehen erhalten bleibt. Der Verlauf ist individuell verschieden, sogar zwischen Geschwistern mit derselben genetischen Veränderung.
Behandlungsmöglichkeiten
Eine Heilung gibt es bisher nicht. Dennoch können Maßnahmen die Beschwerden lindern und den Alltag erleichtern:
- Hilfsmittel: Vergrößernde Sehhilfen, Bildschirmlesegeräte oder Vorlese-Apps.
- Lichtschutz: Spezial-Sonnenbrillen reduzieren Blendung und schonen die Netzhaut.
- Ernährung: Hohe Dosen Vitamin A sollten vermieden werden. Eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst, Gemüse und Omega-3-Fettsäuren unterstützt die Augengesundheit.
- Forschung: Gentherapien und Stammzelltherapien befinden sich in klinischen Studien und geben Hoffnung auf zukünftige Therapien.
Leben mit Morbus Stargardt
Die Diagnose ist für Betroffene und ihre Familien oft schwer. Umso wichtiger ist Unterstützung im Alltag:
- Psychologische Begleitung: Hilft, die Erkrankung anzunehmen und Strategien zu entwickeln.
- Schule und Beruf: Nachteilsausgleiche, spezielle Hilfsmittel und Beratung sichern Teilhabe.
- Selbsthilfegruppen: Austausch mit anderen Betroffenen vermittelt Zuversicht und Verständnis.
Fazit
Morbus Stargardt ist eine seltene, genetisch bedingte Erkrankung, die schon in jungen Jahren beginnt und das zentrale Sehen nach und nach verschlechtert. Auch wenn eine Heilung derzeit nicht möglich ist, gibt es viele Hilfen, die ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Forschungsergebnisse lassen zudem hoffen, dass in Zukunft neue Therapien den Krankheitsverlauf verlangsamen oder sogar aufhalten können.






