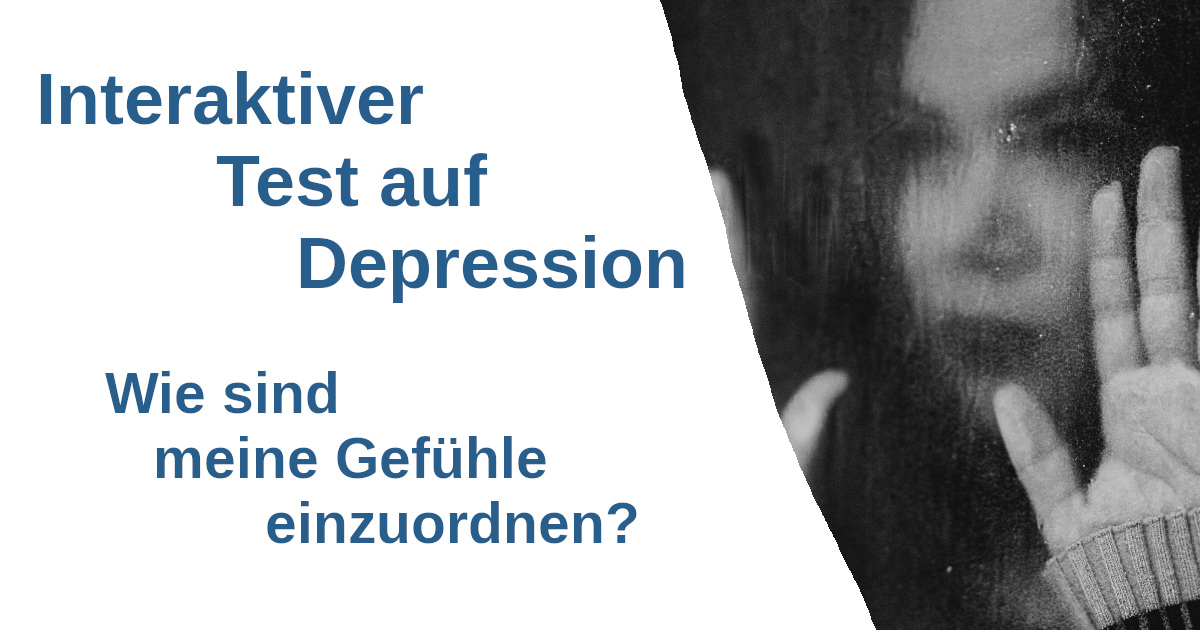Autor: Mazin Shanyoor
Wenn in den Medien Schlagzeilen auftauchen, die den Eindruck erwecken, Depressionen seien „ansteckend“, löst das bei vielen Menschen Verunsicherung, Angst und nicht selten auch Schuldgefühle aus. Wer selbst betroffen ist, fragt sich vielleicht: Belaste ich meine Familie, meine Freunde, meine Kollegen? – während Angehörige befürchten könnten, dass Nähe und Zuwendung zu einem Risiko werden. Genau hier setzt die Stellungnahme der Stiftung Deutsche Depressionshilfe an, die mit Nachdruck betont: Depressionen sind keine Infektionskrankheit. Der Begriff der „sozialen Ansteckung“ ist nicht nur wissenschaftlich fragwürdig, sondern auch gefährlich, weil er Stigmatisierung und Ausgrenzung verstärken kann.

Der Hintergrund: Studien aus Finnland und Dänemark
In zwei aktuellen Untersuchungen aus Finnland und Dänemark wurde ein Zusammenhang zwischen dem Umfeld und dem Auftreten von Depressionen hergestellt. So kamen die finnischen Forscher zu dem Ergebnis, dass Schülerinnen und Schüler häufiger depressiv erkranken, wenn in ihrer Klasse bereits mehrere Betroffene sind. In der dänischen Studie zeigte sich, dass in Unternehmen die Zahl von Depressionsdiagnosen steigt, wenn Mitarbeitende mit psychischen Erkrankungen neu hinzukommen.
Solche Befunde lassen sich schnell missverstehen – und sie bergen die Gefahr, als Beleg für eine „Ansteckungsgefahr“ interpretiert zu werden. Doch genau das wäre eine Fehlinterpretation.
Warum diese Studien kein Beweis für „Ansteckung“ sind
Die Stiftung weist darauf hin, dass Depression in erster Linie auf einer individuellen Veranlagung beruht. Diese kann genetisch bedingt sein oder durch prägende Erlebnisse, etwa Missbrauch oder traumatische Erfahrungen in der Kindheit, entstehen. Wer diese Veranlagung nicht hat, wird auch durch schwierige Lebensumstände oder durch den Kontakt zu erkrankten Menschen nicht automatisch depressiv.
Hinzu kommt: Die Häufigkeit von Diagnosen ist nicht dasselbe wie die tatsächliche Häufigkeit von Erkrankungen. In Deutschland zeigen bevölkerungsrepräsentative Studien über Jahrzehnte hinweg keine wesentliche Zunahme der Erkrankungsraten. Gleichzeitig sind die Diagnosen jedoch deutlich häufiger geworden.
Das liegt vor allem an zwei positiven Entwicklungen:
- Mehr Wissen und Aufklärung: Durch Kampagnen und Aufklärungsarbeit erkennen heute mehr Menschen die Symptome und suchen Hilfe.
- Weniger Stigma: Depression wird zunehmend als Erkrankung verstanden und nicht mehr nur als „schlechte Laune“ oder „Burnout“.
Vor diesem Hintergrund ist die plausibelste Erklärung für die Ergebnisse der Studien nicht eine „Übertragung“, sondern eine niedrigere Hemmschwelle, über psychische Probleme zu sprechen und Hilfe anzunehmen, wenn andere im Umfeld diesen Schritt schon getan haben.
Warum die Sprache so entscheidend ist
Von „Ansteckung“ zu sprechen, ist mehr als nur ungenau. Es hat reale Folgen: Betroffene könnten sich schuldig fühlen, weil sie glauben, für die Erkrankung anderer verantwortlich zu sein. Angehörige und Kollegen könnten Abstand suchen – aus Angst, selbst „infiziert“ zu werden. Eine solche Denkweise verstärkt genau das, wogegen seit Jahren gearbeitet wird: die Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen.
Professor Ulrich Hegerl bringt es in der Stellungnahme auf den Punkt: Es sei „fatal und völlig unverantwortlich“, Menschen mit Depression in die Nähe eines Infektionsrisikos zu rücken. Denn dadurch würden unbegründete Ängste, Distanzierungen und Schuldgefühle erzeugt.
Ein Blick auf die Realität
Depression ist eine schwere, aber behandelbare Erkrankung. Sie betrifft Menschen unabhängig von Status, Beruf oder sozialem Umfeld. Niemand ist „schuld“ daran, weder die Betroffenen selbst noch ihre Angehörigen. Was hilft, sind Verständnis, Unterstützung und der Mut, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Dass heute mehr Diagnosen gestellt werden, ist letztlich eine positive Entwicklung: Es zeigt, dass weniger Menschen mit ihrem Leiden allein bleiben, dass Ärztinnen, Therapeuten und die Gesellschaft sensibler geworden sind und dass die Erkrankung endlich beim Namen genannt wird.
Fazit
Die Vorstellung einer „sozialen Ansteckung“ von Depression ist nicht nur wissenschaftlich unbegründet, sondern gesellschaftlich schädlich. Depressionen sind keine Infektionskrankheiten, sondern komplexe psychische Erkrankungen, die aus einer Mischung von Veranlagung und belastenden Lebensumständen entstehen.
Statt Angst vor Nähe zu verbreiten, brauchen wir mehr Offenheit, Solidarität und Unterstützung für die Millionen Betroffenen. Jeder Schritt, der das Schweigen bricht, trägt dazu bei, dass weniger Menschen im Dunkeln leiden müssen – und genau das ist ein Fortschritt, den wir nicht kleinreden sollten.