Sie haben keinen Geruch, keinen Geschmack und keine Farbe. Niemand sieht sie, niemand spürt sie – und doch sind sie überall: in unserem Blut, in unseren Böden, in der Luft und im Wasser. PFAS – das steht für per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, eine Stoffgruppe, die die moderne Industrie revolutionierte und gleichzeitig eine ökologische Katastrophe von beispiellosem Ausmaß ausgelöst hat.
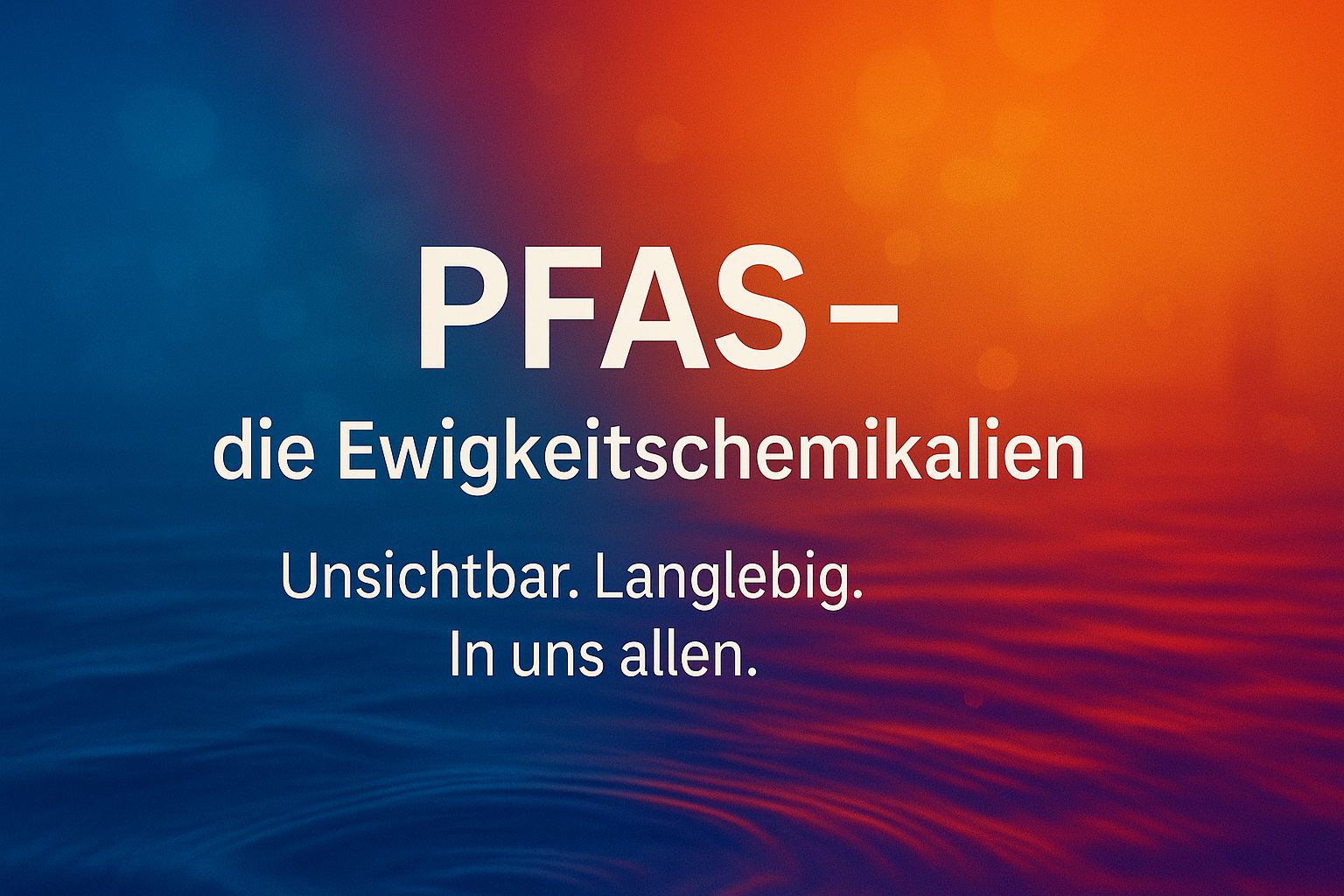
Was in den 1940er-Jahren als Wundermaterial gefeiert wurde, gilt heute als Symbol menschlicher Kurzsichtigkeit. PFAS sind das Produkt einer Ära, die glaubte, alles beherrschen zu können – Chemie, Natur, Zeit. Doch Zeit ist genau das, was diese Stoffe überdauern. Sie zerfallen nicht, sie verschwinden nicht, sie begleiten uns für Generationen. Daher ihr Beiname: Ewigkeitschemikalien.
Was PFAS sind – und warum sie „ewig“ bleiben
PFAS ist keine einzelne Substanz, sondern eine Familie von über 10.000 Verbindungen. Gemeinsam ist ihnen die extrem stabile Kohlenstoff–Fluor-Bindung (C–F). Sie macht PFAS hitze-, wasser- und fettabweisend – und in der Umwelt praktisch nicht abbaubar. Weder UV-Licht, Mikroorganismen noch übliche Klärprozesse zerlegen diese Moleküle zuverlässig.
Vom Laborerfolg zur globalen Belastung
Seit den 1940ern fanden PFAS ihren Weg in Antihaftbeschichtungen, Textilien, Papier, Lacke, Feuerlöschschäume, Kosmetika und Medizinprodukte. Erst ab den 1990ern wurde klar: PFAS tauchten im Blut unbeteiligter Menschen, in Wildtieren und in entlegenen Ökosystemen auf – ein Hinweis auf einen weltweiten, dauerhaften Stoffkreislauf.
Wo PFAS überall vorkommen
- Haushalt & Küche: Antihaftpfannen, Backformen, Backpapier, Mikrowellen-Popcorntüten
- Textilien: Regenjacken, Wanderschuhe, Teppiche, Sofabezüge, Arbeitskleidung
- Lebensmittelverpackungen: Pizzakartons, Fast-Food-Schalen, To-go-Becher
- Kosmetik: wasserfeste Mascara, Lippenstifte, Sonnenschutz (Inci: PTFE, „Perfluoro-“, „Polyfluoro-“)
- Industrie & Medizin: Dichtungen, Kabelisolierungen, Katheter, Spezialbeschichtungen
- Feuerwehr & Militär: fluorhaltige Löschschäume als besonders große Eintragsquelle
Unsichtbar, aber überall – wie PFAS sich verbreiten
Flüchtige PFAS gelangen in die Atmosphäre und werden mit Niederschlag über weite Distanzen verteilt. Andere lösen sich im Wasser, binden an Partikel oder wandern im Grundwasser. Über Pflanzen, Fische und tierische Produkte gelangen sie in die Nahrungskette. Messprogramme zeigen: Ein Großteil der Weltbevölkerung trägt messbare PFAS-Spiegel im Blut.
Gesundheitliche Folgen – was die Forschung nahelegt
Die gesundheitlichen Auswirkungen von PFAS zählen heute zu den meistuntersuchten Themen der Umweltmedizin. Auch wenn nicht jede einzelne Verbindung gleich wirkt, ergibt sich aus Hunderten von Studien ein eindeutiges Bild: PFAS können die normalen biologischen Abläufe des Körpers subtil, aber nachhaltig stören. Sie greifen in Stoffwechselprozesse ein, beeinflussen hormonelle Regelkreise und können langfristig krank machen – nicht durch akute Vergiftung, sondern durch langsame, kumulative Belastung über viele Jahre hinweg.
Leber & Stoffwechsel
Die Leber ist das zentrale Organ für Entgiftung und Fettstoffwechsel – und eines der Hauptziele von PFAS. Forschungen zeigen, dass bereits geringe Konzentrationen im Blut Leberenzyme wie ALT und AST erhöhen können. Dies gilt als Zeichen einer beginnenden Leberzellbelastung. Gleichzeitig verändern PFAS den Fettstoffwechsel: sie erhöhen den Gesamtcholesterinspiegel und vor allem das „schlechte“ LDL-Cholesterin, während HDL-Cholesterin häufig sinkt. Diese Veränderungen gelten als Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und treten selbst bei Menschen auf, die keine klassischen Risikofaktoren wie Übergewicht oder schlechte Ernährung aufweisen. Die Leber fungiert also als stiller Speicher, in dem PFAS über Jahre akkumulieren können.
Immunsystem
Einer der auffälligsten Effekte betrifft das Immunsystem. Kinder, die in PFAS-belasteten Regionen leben, zeigen laut mehreren epidemiologischen Studien eine verminderte Impfantwort – das heißt, sie bilden nach Impfungen weniger Antikörper. Diese Erkenntnis gilt als starkes Indiz dafür, dass PFAS die Immunregulation beeinflussen können. Betroffene zeigen teils auch eine erhöhte Infektanfälligkeit für Atemwegs- oder Magen-Darm-Erkrankungen. Das Immunsystem reagiert also abgeschwächt – nicht zerstört, aber gedämpft. Diese Erkenntnisse haben dazu geführt, dass internationale Behörden wie die EFSA und die EPA PFAS mittlerweile als „besonders besorgniserregend“ für die kindliche Entwicklung einstufen.
Endokrine Effekte
PFAS zählen zu den sogenannten endokrinen Disruptoren – also Stoffen, die in den Hormonhaushalt eingreifen können. Sie beeinflussen die Bildung und Wirkung von Schilddrüsen-, Geschlechts- und Stresshormonen. Bei Männern wurden in mehreren Studien leicht verringerte Testosteronspiegel und reduzierte Spermienqualität beschrieben; bei Frauen Zyklusstörungen und verlängerte Zeit bis zur Schwangerschaft. Besonders empfindlich reagieren Feten und Neugeborene, deren hormonelle Steuerung noch nicht ausgereift ist. Schon minimale Störungen in der frühen Entwicklung können später zu Stoffwechsel- oder Fortpflanzungsproblemen führen. Die hormonähnlichen Eigenschaften vieler PFAS machen sie deshalb langfristig so riskant: sie wirken nicht stark, aber konstant – Tag für Tag, Jahr für Jahr.
Krebsrisiken
Einige PFAS, insbesondere PFOA (Perfluoroctansäure) und PFOS (Perfluoroctansulfonat), stehen im Verdacht, das Krebsrisiko zu erhöhen. Die größten epidemiologischen Untersuchungen – unter anderem die „C8 Health Study“ in den USA – zeigen statistisch signifikante Zusammenhänge zwischen langjähriger PFAS-Exposition und einem erhöhten Risiko für Nierenkrebs sowie Hodenkrebs. Auch Hinweise auf Leberkrebs und Schilddrüsenkarzinome mehren sich. Die Mechanismen sind noch nicht vollständig geklärt, doch Tierstudien zeigen, dass PFAS oxidativen Stress fördern, Entzündungsprozesse aktivieren und die Zellteilung beeinflussen können – typische Vorstufen für Tumorbildung. Wichtig ist: Nicht jede Exposition führt zu Krebs. Entscheidend ist die Dauer und Höhe der Belastung – doch da PFAS im Körper nur extrem langsam abgebaut werden, steigt das Risiko mit jedem Jahr der Anreicherung.
Schwangerschaft & Entwicklung
PFAS überqueren die Plazenta und gelangen bereits im Mutterleib in den kindlichen Blutkreislauf. In Studien wurde eine Korrelation zwischen höheren PFAS-Spiegeln im mütterlichen Blut und geringerem Geburtsgewicht festgestellt. Manche Forscher vermuten zudem Auswirkungen auf die Gehirnentwicklung, etwa leicht verminderte Aufmerksamkeit und langsamere Reaktionszeiten im Kindesalter – Hinweise, die noch untersucht werden, aber beunruhigend sind. Auch beim Stillen werden PFAS in geringen Mengen über die Muttermilch weitergegeben. Zwar überwiegen die Vorteile des Stillens deutlich, doch das zeigt, wie tief PFAS in biologische Kreisläufe eingreifen – von der Schwangerschaft bis zur frühen Kindheit.
Langzeitbelastung und Halbwertszeiten
Ein entscheidender Aspekt ist die lange Verweildauer im Körper. Die sogenannte Halbwertszeit – also die Zeit, bis die Hälfte einer aufgenommenen Menge ausgeschieden ist – liegt je nach PFAS-Typ zwischen 3 und 8 Jahren. Das bedeutet: Selbst wenn der Kontakt mit PFAS vollständig beendet würde, bleibt ein Teil der Substanzen viele Jahre im Organismus aktiv. Diese Dauer erklärt, warum selbst geringe, alltägliche Dosen langfristig relevant sind: Es entsteht eine kumulative Exposition – kleine Mengen summieren sich über Jahrzehnte zu einer Gesamtbelastung, die der Körper nicht mehr abbauen kann.
Die Forschung zu PFAS steht in manchen Bereichen noch am Anfang, doch der Trend ist eindeutig: Es handelt sich nicht um harmlose Industriechemikalien, sondern um Stoffe, die tief in die biologischen Systeme eingreifen – leise, unsichtbar, aber nachhaltig. Je länger sie in uns und um uns bleiben, desto deutlicher werden ihre Spuren.
PFAS in Böden und Gewässern – ein Sanierungsdilemma
Einmal eingetragen, bleiben PFAS in Sedimenten, Böden und Grundwasser. Sanierungen erfordern aufwendige Aktivkohle- oder Membranverfahren; vollständige Beseitigung ist selten erreichbar. Kommunen investieren Millionen in Aufbereitung – eine Generationenaufgabe.
Regulierung, Forschung und Ersatzstoffe
PFAS sind längst mehr als ein chemisches oder industrielles Thema – sie sind zu einem politischen Prüfstein für Umweltverantwortung geworden. Über Jahrzehnte wurden diese Stoffe weltweit eingesetzt, ohne dass ihre Langzeitfolgen umfassend bewertet wurden. Nun steht die Gesellschaft an einem Wendepunkt: Die Erkenntnisse über ihre Toxizität und Persistenz sind erdrückend, doch ein vollständiger Ausstieg ist technisch und wirtschaftlich eine Herausforderung historischen Ausmaßes.
Regulierung in Europa – das größte Chemikalienverbot der Geschichte?
Seit 2023 liegt der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) ein gemeinsamer Antrag von fünf Staaten – Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen und den Niederlanden – vor, der ein weitreichendes Verbot aller PFAS fordert, sofern sie nicht als „unverzichtbar“ gelten. Dieses Vorhaben wäre eines der umfassendsten Chemikalienverbote der Menschheitsgeschichte. Ziel ist es, die Produktion, den Import und die Nutzung von PFAS in den meisten Anwendungsbereichen innerhalb der nächsten Jahre zu unterbinden. Der Entwurf umfasst mehr als 10.000 Substanzen – ein gewaltiger Schritt, da PFAS bisher oft einzeln reguliert wurden und so viele Umgehungsprodukte entstehen konnten. Der neue Ansatz soll erstmals die gesamte Stoffgruppe einheitlich behandeln.
Die geplante Regulierung sieht differenzierte Übergangsfristen vor: Für leicht ersetzbare Anwendungen wie Textilbeschichtungen oder Kosmetika sollen kurze Fristen gelten (z. B. 18 Monate). Für technisch komplexe Branchen – etwa die Halbleiterfertigung, Luft- und Raumfahrt oder bestimmte medizinische Geräte – könnten längere Übergangszeiten von fünf bis zwölf Jahren vorgesehen werden. Diese Regelung berücksichtigt, dass PFAS in einigen Hochtechnologien derzeit noch keine gleichwertigen Alternativen haben.
Internationale Entwicklungen
Auch außerhalb Europas wächst der Druck. In den USA hat die EPA neue Grenzwerte für PFAS im Trinkwasser festgelegt – so niedrig, dass sie praktisch an der Nachweisgrenze liegen. Einige Bundesstaaten, etwa Maine und Kalifornien, haben bereits Gesetze verabschiedet, die PFAS in Konsumprodukten, Textilien und Lebensmittelverpackungen verbieten. Kanada und Australien folgen mit eigenen Restriktionen. Auf globaler Ebene wird diskutiert, PFAS als „persistente organische Schadstoffe“ (POPs) nach der Stockholmer Konvention einzustufen. Damit würden sie in die gleiche Kategorie wie Dioxine oder PCB fallen – Substanzen, deren Einsatz weltweit geächtet ist.
Wissenschaft und Abbautechnologien
Parallel zu politischen Initiativen arbeiten Forschungsinstitute weltweit an der entscheidenden Frage: Wie lassen sich PFAS wieder abbauen? Denn herkömmliche Reinigungsverfahren versagen: PFAS überstehen Kläranlagen, Aktivkohlefilter und selbst Hochtemperaturverbrennungen über 1.000 °C teilweise unbeschadet.
Neue Verfahren setzen auf elektrochemische Prozesse, bei denen elektrische Ströme in Kombination mit Katalysatoren die starke Kohlenstoff-Fluor-Bindung aufbrechen sollen. Andere Ansätze nutzen Photokatalyse oder Plasmatechnologie, um die Moleküle in reaktionsfreudigere Zwischenprodukte zu zerlegen, die sich anschließend abbauen lassen. Einige Universitäten, darunter die ETH Zürich und die University of California, konnten im Labor bereits nachweisen, dass PFAS bei gezielten Bedingungen in harmlose Endprodukte wie Kohlendioxid und Fluorid zerfallen. Allerdings befinden sich diese Verfahren noch im experimentellen Stadium – sie sind teuer, energieintensiv und für großtechnische Anwendungen bislang nicht skalierbar.
Ein weiterer Forschungspfad untersucht spezielle Reagenzien und Enzyme, die PFAS biologisch oder chemisch spalten könnten. Diese Ansätze zielen darauf ab, die Moleküle in kontrollierten Reaktoren zu „entschärfen“, bevor sie überhaupt in die Umwelt gelangen. Doch bis aus diesen Laborlösungen praktikable Technologien werden, wird noch viel Zeit vergehen.
Ersatzstoffe und neue Materialkonzepte
Während die Beseitigung existierender PFAS eine langfristige Aufgabe bleibt, konzentrieren sich viele Unternehmen auf die Entwicklung fluorfreier Alternativen. In der Textilindustrie gibt es bereits erste Produkte mit sogenannten „fluorcarbonfreien Imprägnierungen“, die auf Silikon-, Wachs- oder Polyurethanbasis funktionieren. Diese Stoffe erreichen zwar (noch) nicht die gleiche Haltbarkeit wie PFAS, sind aber deutlich umweltverträglicher und biologisch abbaubar.
Auch die Verpackungsbranche arbeitet an neuen Konzepten: Zellulosebeschichtungen, pflanzenbasierte Wachse und spezielle Tonmineralien ersetzen zunehmend PFAS-haltige Barrieren in Papp- und Papierverpackungen. Große Fast-Food-Ketten haben bereits angekündigt, weltweit auf fluorfreie Verpackungen umzustellen. In der Medizintechnik und Elektronik wird parallel an neuartigen Polymerbeschichtungen geforscht, die hitze- und chemikalienbeständig sind, aber keine persistente Fluorchemie verwenden.
Eine wachsende Rolle spielt zudem das Prinzip der „Essential Use“-Bewertung. Dieses Konzept, von Wissenschaftlern um Ian Cousins (Stockholm University) vorgeschlagen, soll helfen zu unterscheiden, wo PFAS wirklich unverzichtbar sind – etwa in Herzkathetern oder bei der Halbleiterproduktion – und wo sie durch nachhaltige Alternativen ersetzt werden können. Dieses Prinzip könnte zum Leitmotiv der zukünftigen Chemikalienpolitik werden.
Ein neues Verständnis von Verantwortung
Die PFAS-Debatte zwingt Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zu einem Umdenken: Es reicht nicht mehr, nur zu regulieren – es braucht eine neue Ethik des Chemieeinsatzes. Künftig wird entscheidend sein, ob Stoffe über ihre gesamte Lebensdauer – von der Produktion bis zur Entsorgung – sicher und abbaubar bleiben. Die Ära der „Ewigkeitschemikalien“ zeigt, wie gefährlich es ist, Stabilität mit Sicherheit zu verwechseln. Forschung und Innovation stehen daher vor einer klaren Aufgabe: Materialien zu schaffen, die der Natur nicht widersprechen, sondern sich wieder in sie einfügen können.
Ob das gelingt, wird bestimmen, wie die Menschheit künftig mit der Chemie ihrer eigenen Erfindungen umgeht. PFAS sind in dieser Hinsicht Prüfstein und Mahnung zugleich.
Was du konkret tun kannst
Die Belastung durch PFAS ist ein globales Problem, das nicht allein durch individuelles Handeln gelöst werden kann – doch jeder Einzelne kann einen Beitrag leisten, um den eigenen Kontakt zu reduzieren und das Thema gesellschaftlich sichtbar zu machen. Die meisten Expositionen entstehen unbemerkt: beim Kochen, Tragen, Einkaufen oder Putzen. Bewusste Entscheidungen im Alltag können die Aufnahme deutlich verringern und zugleich ein Signal an Politik und Industrie senden. Die folgenden Schritte sind einfach umsetzbar – und sie zeigen, dass Verantwortung im Kleinen beginnt.
Pfannen und Kochgeschirr – auf Dauer statt Beschichtung setzen
Antihaftpfannen sind bequem, doch viele ältere Modelle enthalten PFAS-basierte Beschichtungen wie PTFE (Polytetrafluorethylen), bekannt unter dem Markennamen Teflon. Beim Erhitzen können sich Partikel lösen, und die Entsorgung solcher Pfannen führt zu PFAS-Einträgen in die Umwelt. Eine nachhaltige Alternative sind Pfannen aus Edelstahl, Gusseisen oder Emaille. Sie halten jahrzehntelang, entwickeln mit der Zeit eine natürliche Antihaftschicht (Patina) und enthalten keine Fluorverbindungen. Achte beim Neukauf darauf, dass das Produkt ausdrücklich als „PFAS-frei“ oder „ohne PTFE“ gekennzeichnet ist. Auch moderne Keramikbeschichtungen können eine gute Alternative sein – sofern sie keine fluorierten Bindemittel enthalten (ein Blick auf die Herstellerangaben lohnt sich).
Textilien und Outdoor-Ausrüstung – „PFC-frei“ ist das neue Qualitätsmerkmal
Outdoorjacken, Regenhosen und Wanderschuhe sind häufig mit wasser- und schmutzabweisenden Beschichtungen aus PFAS behandelt. Diese sorgen dafür, dass Wasser abperlt – aber sie gelangen beim Waschen in Flüsse und Kläranlagen. Immer mehr Hersteller bieten inzwischen fluorfreie Imprägnierungen auf Basis von Wachsen, Silikonen oder Polyurethan an. Produkte mit dem Hinweis „PFC-frei“, „fluorcarbonfrei“ oder „PFAS-frei“ sind eine bewusste Wahl. Auch ältere, noch PFAS-haltige Kleidung sollte nicht unnötig häufig gewaschen werden – dadurch reduziert man den Abrieb und den Eintrag ins Abwasser. Wer Textilien selbst imprägniert, findet im Fachhandel umweltfreundliche Sprays und Waschzusätze ohne Fluorchemie. Der leichte Unterschied in der Dauerhaftigkeit lohnt sich, wenn man bedenkt, dass jedes Waschbecken und jeder Fluss Teil des globalen Kreislaufs ist.
Lebensmittel und Verpackungen – frische Ware bevorzugen
Ein unterschätzter PFAS-Eintrag entsteht über Lebensmittelverpackungen. Besonders fett- und wasserabweisende Papiere, etwa für Pommes, Burger, Pizza oder Backwaren, werden oft mit PFAS-basierten Barrieren beschichtet. Auch Pappbecher für Kaffee oder Suppen sind häufig betroffen. Wer kann, sollte frische, unverpackte Lebensmittel bevorzugen oder eigene Behälter für To-go-Gerichte mitbringen. In immer mehr Cafés ist das bereits möglich. Beim Einkauf von Backpapier, Butterbrotpapier oder Einwegschalen lohnt sich ein Blick auf die Kennzeichnung: Hersteller werben zunehmend mit „ohne PFAS“ oder „fluorfrei“ – ein Fortschritt, der durch bewusste Nachfrage beschleunigt wird. Wer regelmäßig selbst kocht, senkt die Aufnahme zusätzlich, da PFAS auch in fetthaltigen Fertigprodukten nachgewiesen wurden, die in beschichteten Anlagen verarbeitet werden.
Trinkwasser – prüfen und filtern, wenn nötig
In Deutschland wird Trinkwasser streng überwacht, doch PFAS sind schwer zu erfassen, da sie selbst in winzigsten Mengen vorkommen. Die Belastung kann regional stark variieren – insbesondere in der Nähe ehemaliger Militärstandorte, Flughäfen oder Industriegebiete. Auf den Webseiten vieler Stadtwerke finden sich bereits PFAS-Messwerte; andernfalls lohnt eine Anfrage beim örtlichen Wasserversorger. Bei erhöhten Werten können Aktivkohlefilter oder Umkehrosmose-Anlagen einen Großteil der PFAS entfernen. Aktivkohle bindet die Moleküle physikalisch, muss aber regelmäßig gewechselt werden. Umkehrosmose-Systeme sind effektiver, erfordern jedoch Wartung und einen gewissen Energieaufwand. Wer stilles Wasser in Flaschen kauft, sollte darauf achten, dass es aus Quellen mit dokumentiert niedrigen PFAS-Werten stammt – manche Marken veröffentlichen entsprechende Analysen freiwillig.
Kosmetik und Pflegeprodukte – kleine Buchstaben, große Wirkung
PFAS werden auch in der Kosmetikindustrie verwendet – etwa, um Make-up länger haltbar, Cremes wasserfest oder Lippenstifte besonders glatt zu machen. Auf der Verpackung stehen sie oft gut versteckt: Achte in der Inhaltsstoffliste (INCI) auf Begriffe wie PTFE, Perfluoroalkyl, Polyfluoroalkyl oder Kürzel wie C6- bzw. C8-Fluoro. Wer solche Begriffe findet, kann davon ausgehen, dass PFAS enthalten sind. Alternativen bieten Naturkosmetikmarken oder Produkte, die explizit mit „ohne Fluorverbindungen“ gekennzeichnet sind. Besonders wichtig ist der Verzicht bei Lippenprodukten oder Foundation, die direkt mit der Haut in Kontakt stehen. Jede Reduktion senkt die Aufnahme über Schleimhäute und Hautporen – und jede Nachfrage nach PFAS-freien Produkten stärkt Hersteller, die auf nachhaltige Rezepturen setzen.
Politisches und gesellschaftliches Engagement – Wandel braucht Stimme
Individuelle Vorsicht ist wichtig, doch der nachhaltige Wandel entsteht erst durch öffentlichen Druck. Verbraucher können viel bewirken, wenn sie Fragen stellen und Transparenz einfordern. Du kannst bei deiner Kommune oder deinem Wasserversorger nach aktuellen PFAS-Messungen fragen, Petitionen unterstützen oder an Informationsveranstaltungen teilnehmen. Auch das Schreiben an Abgeordnete oder Umweltministerien zeigt Wirkung – insbesondere, wenn es um regionale Belastungen geht. Unterstütze Organisationen, die sich für sauberes Wasser und PFAS-Verbote einsetzen, oder teile Informationen in sozialen Medien. Jede Stimme zählt, denn politische Prozesse beschleunigen sich, wenn Öffentlichkeit entsteht.
Fazit – kleine Entscheidungen, große Wirkung
PFAS sind in der modernen Welt nahezu allgegenwärtig, doch das bedeutet nicht, dass man ihnen hilflos ausgeliefert ist. Jede bewusste Entscheidung – ob beim Einkauf, Kochen, Anziehen oder Wählen – schwächt die Nachfrage nach Produkten, die unsere Umwelt belasten. Die Kraft liegt im Gewohnheitswandel: Wenn Millionen Menschen anfangen, auf PFAS zu verzichten, wird die Industrie reagieren. Was heute noch als Nischenentscheidung gilt, kann morgen der neue Standard sein – eine Welt, in der Langlebigkeit nicht mehr mit Ewigkeit verwechselt wird.
Fazit – die Ewigkeit im Alltag
PFAS stehen für die Schattenseite cleverer Chemie: enorme Nützlichkeit zum Preis langfristiger Umwelt- und Gesundheitslasten. Der Weg heraus führt über ehrliche Kennzeichnung, konsequente Regulierung, Innovation – und über unser Konsumverhalten. Ewigkeit sollte kein Kriterium für Gifte sein.






