Vor wenigen Jahren galten sie noch als kleine Revolution im Supermarktregal: Süßstoffe – die kalorienfreien Helfer, die Zucker ersetzen sollten. Sie machten Diätgetränke möglich, Desserts ohne Reue und versprachen Genuss ohne Folgen. Wer wollte da nicht zugreifen? Kein Zucker, kein Fett, kein Problem – so schien es.
Doch inzwischen gerät dieses Bild ins Wanken. Immer mehr Studien weisen darauf hin, dass künstliche Süßstoffe keineswegs so neutral sind, wie lange angenommen. Die neueste Untersuchung, veröffentlicht im Fachjournal Neurology, liefert nun besonders beunruhigende Hinweise: Menschen, die regelmäßig Süßstoffe konsumieren, schneiden bei Gedächtnistests langfristig schlechter ab – ihr Gehirn altert offenbar schneller.
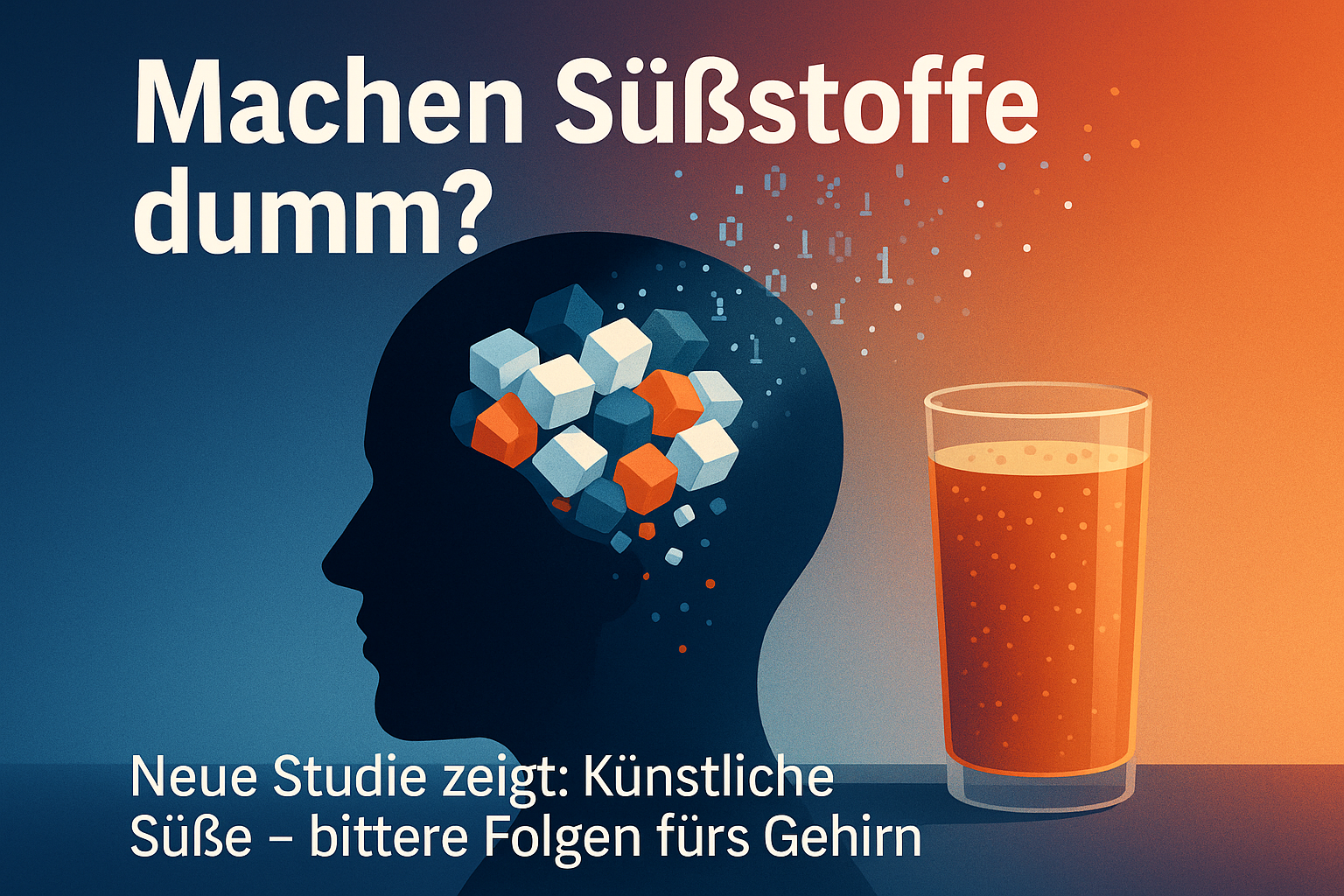
Die Studie im Überblick
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität São Paulo begleiteten über acht Jahre hinweg mehr als 12.700 Erwachsene mittleren Alters. Alle gaben an, wie häufig sie Süßstoffe konsumierten – etwa über Diät-Getränke, Light-Produkte, Proteinshakes oder zuckerfreie Joghurts. Anschließend wurden die kognitiven Fähigkeiten der Teilnehmenden regelmäßig überprüft: Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Sprachverständnis und Reaktionsgeschwindigkeit.
Das Ergebnis war deutlich: Personen mit dem höchsten Süßstoffkonsum zeigten eine um 62 Prozent schnellere Abnahme der geistigen Leistungsfähigkeit als jene, die kaum oder gar keine Süßstoffe zu sich nahmen. Besonders betroffen waren Menschen unter 60 Jahren und solche mit Diabetes.
Die Forschenden kamen zu dem Schluss, dass ein hoher Konsum künstlicher Süßstoffe mit einem umgerechnet 1,6 Jahre älteren „Gehirnalter“ einherging. Dieser Effekt blieb bestehen, selbst wenn andere Faktoren wie Ernährung, Bewegung, Bildung und Gewicht berücksichtigt wurden.
„Unsere Ergebnisse zeigen, dass künstliche Süßstoffe nicht so harmlos sind, wie man lange dachte“, schreiben die Autoren. „Insbesondere jüngere Menschen und Diabetiker könnten empfindlicher auf die biochemischen Veränderungen reagieren, die durch Süßstoffe ausgelöst werden.“
Warum die Süße bitter werden kann
Die eigentliche Frage lautet: Wie können Süßstoffe das Denken oder Gedächtnis überhaupt beeinflussen? Dafür gibt es mehrere plausible Erklärungsansätze.
Unser Gehirn ist eng mit dem Stoffwechsel verbunden. Es reagiert fein auf den Energiehaushalt, insbesondere auf Glukose – den echten Zucker, der als Treibstoff für Nervenzellen dient. Wenn wir etwas Süßes schmecken, erwartet der Körper Energiezufuhr. Kommt diese nicht, kann das hormonelle und neuronale Systeme durcheinanderbringen.
Studien an Tieren haben gezeigt, dass bestimmte Süßstoffe – vor allem Sucralose und Aspartam – das Darmmikrobiom verändern können. Die veränderte Bakterienzusammensetzung wirkt sich wiederum auf den Stoffwechsel, die Insulinempfindlichkeit und die Hirnaktivität aus. Andere Arbeiten deuten auf Entzündungsprozesse hin, die über feine Gefäße auch das Gehirn beeinflussen können.
Hinzu kommt: Süßstoffe verändern unser Belohnungssystem. Das Gehirn „lernt“ eine künstliche Süße, die keine Kalorien liefert. Dadurch kann sich das natürliche Hunger- und Sättigungsgefühl verschieben – ein Effekt, der langfristig auch die Konzentration und emotionale Stabilität beeinflussen kann.
Noch keine Beweise – aber gute Gründe zur Vorsicht
Die Forscher betonen: Es handelt sich um eine Beobachtungsstudie, also um eine Korrelation, keine direkte Ursache-Wirkung-Beziehung. Man kann also nicht sagen: „Süßstoffe machen dumm.“ Aber man kann sehr wohl sagen: „Menschen mit hohem Süßstoffkonsum schneiden schlechter ab – und das ist kein Zufall mehr.“
Das Muster zeigt sich inzwischen in mehreren Studien. Bereits frühere Untersuchungen hatten mögliche Zusammenhänge zwischen Süßstoffkonsum und veränderten Hirnscans, Stimmungsschwankungen oder Konzentrationsproblemen beschrieben. Auch auf das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes wurden in den letzten Jahren Zusammenhänge entdeckt.
Besonders interessant: Nicht alle Süßstoffe sind gleich. Während Sucralose, Aspartam und Acesulfam-K häufiger in der Kritik stehen, schnitt die natürliche Zuckerart Tagatose in der aktuellen Studie neutral ab. Das könnte bedeuten, dass einzelne Substanzen unterschiedlich wirken – ein Feld, das künftig stärker erforscht werden muss.
Und was ist mit Stevia?
Stevia gilt für viele als natürliche und damit harmlose Alternative zu künstlichen Süßstoffen wie Aspartam oder Sucralose. Der Süßstoff wird aus den Blättern der südamerikanischen Pflanze Stevia rebaudiana gewonnen, die in Paraguay und Brasilien schon seit Jahrhunderten als Süßkraut genutzt wird.
Wichtig ist allerdings: Das, was wir in Getränken, Joghurt oder Tablettenform zu uns nehmen, ist nicht das getrocknete Blatt, sondern ein hochkonzentrierter Extrakt – meist Steviolglycoside. Diese werden industriell gereinigt und sind chemisch gesehen ebenfalls isolierte Substanzen, also keine „natürliche“ Nahrung im eigentlichen Sinn.
Die aktuelle Studie aus Neurology hat Stevia nicht ausdrücklich untersucht. Es ging in erster Linie um die sogenannten „Low-and No-Calorie Sweeteners“ (LNCS), zu denen Aspartam, Sucralose, Acesulfam-K, Saccharin und Cyclamat gehören. Stevia wurde zwar als Teil dieser großen Gruppe erwähnt, war aber nicht Gegenstand einer eigenen Auswertung. Daher kann man derzeit nicht sicher sagen, ob die beobachteten Effekte auch für Stevia gelten.
Was es aber gibt, sind erste Labor- und Tierstudien, die darauf hindeuten, dass auch Stevia in hohen Mengen das Mikrobiom verändern und bestimmte Stoffwechselprozesse beeinflussen kann – wenn auch weniger stark als synthetische Süßstoffe. Bei moderatem Konsum wurden bislang keine negativen Effekte auf das Gedächtnis oder die kognitive Leistungsfähigkeit beschrieben.
Mit anderen Worten:
Stevia steht derzeit etwas besser da als viele künstliche Süßstoffe – aber es ist kein Freifahrtschein. Auch hier gilt: Je häufiger, desto fragwürdiger. Die Dosis macht den Unterschied. Wer ab und zu mit Stevia süßt, braucht sich keine Sorgen zu machen. Wer jedoch täglich mehrere Produkte damit konsumiert, sollte ebenso aufmerksam bleiben.
Was das für den Alltag bedeutet
Für den gelegentlichen Konsum – etwa ein zuckerfreies Kaugummi oder eine Cola Light am Wochenende – gibt es keinen Grund zur Sorge. Doch wer täglich mehrere Light-Getränke, Proteinshakes oder Fertigprodukte mit Sucralose oder Aspartam konsumiert, sollte umdenken.
Denn diese Studie legt nahe: Je mehr künstliche Süßstoffe im Alltag, desto höher das Risiko für einen messbaren Leistungsabfall im Denken und Erinnern.
Dabei geht es nicht um Panik, sondern um Bewusstsein. Viele Menschen wissen gar nicht, wie häufig Süßstoffe in Produkten stecken. Sie finden sich in Limonaden, Joghurt, Müsliriegeln, Energydrinks, Diätpuddings, Zahnpasta, ja sogar in Medikamenten. Wer auf die Etiketten achtet, wird überrascht sein, wie oft sich dort Begriffe wie Sucralose, Acesulfam-K, Aspartam, Saccharin oder Cyclamat verstecken.
Wege zu einem gesunden Maß
Ganz auf Süße zu verzichten ist schwer – und auch nicht nötig. Doch kleine Schritte haben große Wirkung:
- Trinke mehr Wasser oder ungesüßten Tee. Mit Zitrone, Ingwer oder Minze schmeckt es frischer, als man denkt.
- Iss echte Lebensmittel. Naturjoghurt, frisches Obst, Haferflocken – sie trainieren die Geschmacksnerven zurück zur natürlichen Süße.
- Wenn Süßstoff, dann bewusst. Tagatose oder Erythrit gelten derzeit als vergleichsweise unbedenklich, solange sie in Maßen verwendet werden.
- Vermeide Dauergebrauch. Tägliche Light-Getränke oder Süßstoffkaffee summieren sich. Versuch, sie schrittweise zu reduzieren.
- Vertraue deinem Geschmack. Schon nach zwei bis drei Wochen weniger Süßem verändert sich die Wahrnehmung: Was früher „normal“ war, wirkt plötzlich zu intensiv.
Fazit: Klarheit statt künstlicher Süße
Süßstoffe sind keine Teufelschemie – aber sie sind auch kein harmloser Ersatz. Die neue Studie zeigt, dass unser Gehirn feinfühliger auf Ernährungsgewohnheiten reagiert, als man lange dachte. Wer regelmäßig große Mengen künstlicher Süßstoffe konsumiert, könnte seinem Denken auf Dauer schaden.
Das bedeutet nicht, dass ein Stück Kaugummi oder ein Light-Getränk das Gedächtnis zerstört. Aber es bedeutet, dass Maßhalten wieder eine Rolle spielt – gerade in einer Zeit, in der künstliche Süße zur Normalität geworden ist.
Vielleicht ist das die eigentliche Botschaft dieser Studie: Bewusster zu leben heißt nicht zu verzichten, sondern zu verstehen. Und wer versteht, dass das Gehirn nicht nur Denkapparat, sondern Teil des ganzen Stoffwechsels ist, der erkennt: Was wir essen, formt, wie wir denken.






