Autor: Mazin Shanyoor
Die Szene ist hochprofessionell: Türen öffnen sich, das Team nimmt Position ein, Instrumente liegen bereit. Eine Operation vermittelt Handlungsstärke, Tempo und technische Souveränität. Genau deshalb erscheint sie vielen als logischer Endpunkt nach Monaten der Beschwerden. Doch sichtbar ist nicht automatisch sinnvoll. Chirurgie ist eine tiefgreifende Intervention in ein komplexes biologisches System; sie entfaltet ihren Wert nur dann, wenn ein gut verstandenes Problem, eine nachweislich wirksame Maßnahme und ein realistisches, persönlich bedeutsames Ziel zusammenfinden. Wo einer dieser Pfeiler wackelt, kippt das Verhältnis von Nutzen zu Risiko, und aus einer starken Tat wird eine schwache Entscheidung.
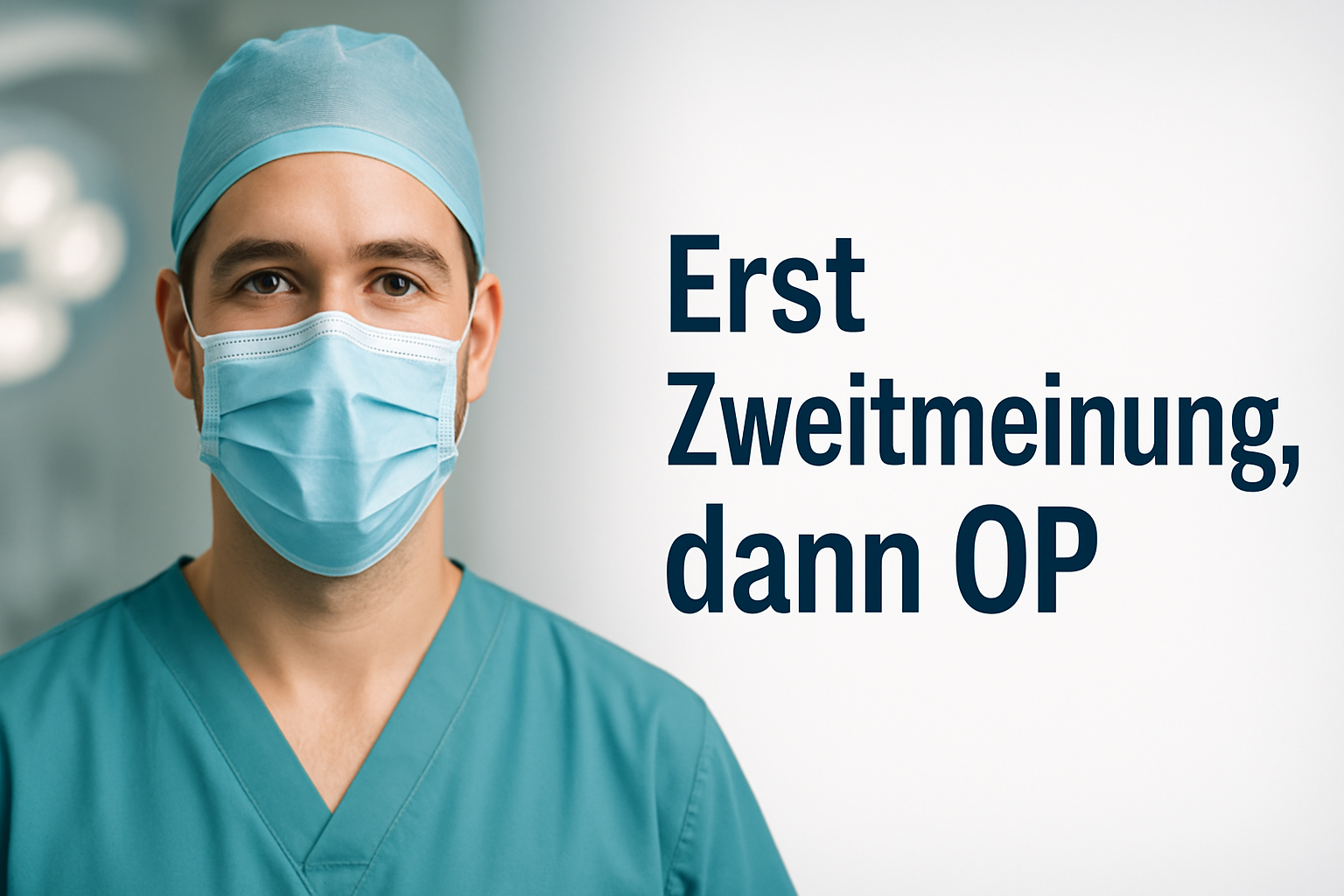
Der vielzitierte „OP-Boom“ ist daher weniger eine moralische Anklage gegen Chirurginnen und Chirurgen als eine Systemdiagnose. In bestimmten Bereichen operieren wir, weil Anreize, Routinen, Bildlogiken und Erwartungsdruck dorthin ziehen – nicht immer, weil die Evidenz zwingt. Wer Überversorgung glaubhaft verringern will, muss die Lücke zwischen können und sollen schließen.
Die Logik des Systems: Wie Geld, Strukturen und Kultur Entscheidungen verschieben
Vergütung prägt Verhalten. Die Fallpauschalen haben Effizienz und Planbarkeit geschaffen, gleichzeitig aber einen leisen Magneten in Richtung Aktivität: bezahlt wird der Fall, nicht die verhinderte Operation. Wer OP-Kapazitäten vorhält, spürt den Druck, sie auszulasten; wer konservativ begleitet, erzeugt für die Buchhaltung „unsichtbare“ Qualität. Diese Logik wirkt selten laut, aber täglich, und sie trifft auf regionale Angebotsunterschiede, die Nachfrage formen. Wo eine Leistung jederzeit verfügbar und identitätsstiftender Bestandteil einer Abteilung ist, sinkt die Schwelle, sie zu empfehlen; gewachsene Abteilungsprofile, Fortbildungstraditionen und lokale Behandlungspfade verstärken diese Tendenz.
Parallel entfaltet die Kultur der Erwartung ihre Kraft. Viele Menschen wünschen eine schnelle, „handfeste“ Lösung; Ärztinnen und Ärzte spüren den impliziten Ruf, entschlossen zu handeln. Bildgebung verstärkt das Narrativ: Was sichtbar ist, wirkt ursächlich – auch wenn degenerative Befunde jenseits der Lebensmitte oft altersphysiologisch sind. So entsteht ein Sog, in dem Operationen als konsequente Medizin erscheinen, während konservative Exzellenz fälschlich wie Abwarten wirkt. Reformen wie Vorhaltefinanzierung, Mindestmengen und Zentrenbildung dämpfen Mengendruck und bündeln Erfahrung; sie werden jedoch erst dann durchgreifend wirksam, wenn Ergebnisqualität – Komplikationen, Re-OP-Raten, patientenberichtete Verbesserungen, Rückkehr in Alltag und Beruf – zur leitenden Währung von Planung, Vergütung und Reputation wird.
Evidenz gegen Gewohnheit: Wo der operative Zusatznutzen überschätzt und Alternativen unterschätzt werden
In mehreren Indikationsfeldern zeigt hochwertige Forschung ein konsistentes Muster: Der durchschnittliche Zusatznutzen bestimmter Operationen ist kleiner als angenommen. Arthroskopien am Knie bei degenerativen Meniskusläsionen liefern langfristig nicht zuverlässig bessere Ergebnisse als strukturierte Physiotherapie, Gewichtsreduktion, Kraftaufbau und gutes Schmerzmanagement. Subakromiale Dekompressionen an der Schulter sind einer konsequenten Übungsbehandlung oft nicht überlegen. Vertebroplastien bei osteoporotischen Wirbelkörperfrakturen zeigten in Schein-Vergleichen keinen robusten Zusatznutzen, während Risiken real bleiben. Auch bei unspezifischen Kreuzschmerzen ist die Versuchung groß, mechanisch zu „lösen“, was funktionell, entzündlich oder psychosozial zu verstehen wäre; Bildbefunde ohne klare klinische Korrelation sind hier Hintergrundrauschen, kein Operationsgrund.
Planbare Eingriffe wie Tonsillektomie oder Hysterektomie entfalten je nach Indikation sehr unterschiedliche Nutzen-Risiko-Profile; gerade hier schwankt die Indikationsqualität zwischen Kliniken und Regionen erheblich. „Unnötig“ bedeutet nicht „immer falsch“, sondern: Der erwartbare Vorteil ist im Durchschnitt klein, unsicher oder auf definierte Untergruppen begrenzt – und ohne konsequenten konservativen Versuch riskiert man zu früh zu viel. Dass operative Routinen dennoch fortbestehen, hat viel mit relativen statt absoluten Effektzahlen, mit Fachtraditionen und mit unterschätzter Qualität konservativer Strategien zu tun, wenn diese nicht strukturiert, belastungsangepasst und mit klaren Reha-Zielen umgesetzt werden.
Diagnostische Präzision vor Therapieeifer: Der „Test der Zeit“ als klinisches Instrument
Überoperationen sind oft das Endprodukt von Unterdiagnostik. Ein MRT zeigt Strukturen, nicht Schmerzen. Degeneration, Bandscheibenvorwölbungen oder Meniskusrisse sind jenseits der 40 häufige Zufallsbefunde; sie werden erst dann klinisch relevant, wenn sie in Anamnese, körperlichem Befund und Funktionsprüfung plausibel korrelieren. Diagnostische Exzellenz bedeutet, Bilder in den Kontext zu stellen: Welche Leitsymptome bestehen? Welche Bewegungen provozieren Beschwerden? Gibt es Red Flags, die sofortiges Handeln erzwingen, oder überwiegen Yellow Flags wie Bewegungsangst, Schonhaltung und muskuläre Dysbalance, die gezielte Therapie und Training erfordern?
Hier wird Zeit zum diagnostischen Werkzeug. Ein strukturierter konservativer Versuch über sechs bis zwölf Wochen – mit dokumentierten Übungen, Belastungssteuerung, analgetischer Unterstützung, ggf. Infiltration, Gewichtsreduktion und realistischen Zwischenzielen – beantwortet die entscheidende Frage: Reagiert das System positiv? Wenn ja, ist eine Operation unwahrscheinlich nötig; wenn nein und die Einschränkung bleibt erheblich, wächst die Indikationsstärke. Kliniken, die verbindliche Pfade vorschreiben – Mindestdauer konservativer Therapie, definierte Reha-Ziele, klare Kriterien für eine OP, interdisziplinäre Indikationsboards –, senken fragwürdige Eingriffe zuverlässig und verbessern zugleich die Ergebnisqualität der Operationen, die dann wirklich stattfinden. Prähabilitation, Erwartungsmanagement und optimierte Medikation machen aus „OP ja“ ein „OP gut vorbereitet“.
Psychologie und Kommunikation: Action Bias, Bildlogik und ehrliche Risiken
Menschen bevorzugen Handlung gegenüber Abwarten, besonders unter Druck. Dieser Action Bias begünstigt operative Entscheidungen. Die Bildlogik verstärkt ihn: Ein sichtbarer Befund „muss“ Ursache sein, und was sichtbar ist, „muss“ repariert werden. Hinzu kommen kognitive Verzerrungen wie der Bestätigungsfehler: Verbesserungen nach einem Eingriff werden dem Eingriff zugeschrieben, obwohl natürliche Verläufe und Placeboeffekte mitwirken. Die Gegenstrategie ist transparente, unaufgeregte Risikokommunikation in absoluten Zahlen: Wie viele von 100 mit deinem Profil profitieren spürbar? Wie viele erleben Komplikationen? Wie lange dauert die Erholung realistisch, gemessen am minimal klinisch bedeutsamen Unterschied, nicht nur an statistischer Signifikanz?
Ehrliche Gespräche öffnen den Blick für Alternativen. Sie klären, was die beste konservative Strategie in zwölf Wochen realistisch leisten kann, was eine Verschiebung der OP bedeutet und welcher Plan B greift, wenn trotz OP der gewünschte Effekt ausbleibt. Shared Decision Making wird damit zur wirksamsten Anti-Übertherapie-Strategie: Wenn Menschen Ziele, Prioritäten und Risikoneigung klar benennen, verschiebt sich die Indikationsschwelle – aus „Wir operieren das“ wird „Wir wählen die Option, die zu dir und deinem Ziel am besten passt“.
Qualität, Spezialisierung und Transparenz: Strukturen, die klügere Indikationen erzwingen
Spezialisierte Zentren mit Mindestmengen liefern nicht nur bessere Technik, sondern diszipliniertere Indikationen: weniger Komplikationen, weniger Re-Operationen, fokussiertere Patientenselektion. Institutionalisierte Lernschleifen – Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen, Peer-Review von Indikationen, Register mit patientenberichteten Ergebnissen, standardisierte Reha-Ziele und verlässliche Follow-ups – verwandeln Einzelentscheidungen in systematisches Qualitätsmanagement. Transparenz ist dabei kein Pranger, sondern Antrieb. Wenn Kliniken ihre Komplikationsraten, Revisionshäufigkeit, PROMs, Rückkehr in Alltag und Beruf sowie Folgetherapie-Bedarf offenlegen, entsteht ein belastbares Bild der Ergebnisqualität. Zuweisende und Patienten können gezielt wählen; Häuser erhalten klare Hinweise, wo Pfade, Schulungen oder Teamaufstellungen verbessert werden müssen.
Politik und Vergütung: Bezahlt werden sollte, was nützt – nicht, was sich rechnet
Gesundheitssysteme bekommen die Versorgung, für die sie bezahlen. Wenn Fallzahlen honoriert werden, steigen Fallzahlen; wenn Nutzen honoriert wird, steigt Nutzen. Vorhaltefinanzierung entkoppelt wirtschaftlichen Druck von der Fallzahl, Zentrenbildung bündelt Erfahrung, Mindestmengen reduzieren Variabilität. Nötig ist eine kluge Mischung aus Basisfinanzierung und Ergebnisorientierung: Kliniken mit belastbar guten Outcomes erhalten Planungssicherheit und Investitionsräume – auch für konservative Exzellenz, Prähabilitation, interdisziplinäre Boards und digitale Entscheidungshilfen. Parallel braucht es De-Implementierung: Verfahren ohne belastbaren Zusatznutzen werden aktiv zurückgedrängt – durch klare Leitlinienpfade, ein starkes Zweitmeinungsrecht, Vergütungsanreize für konservative Alternativen und konsequente Qualitätssicherung. Regionale Netzwerke, in denen komplexe Eingriffe konzentriert und wohnortnahe konservative Behandlung gestärkt wird, schaffen Fairness ohne Qualitätsverlust.
Was du konkret tun kannst: Informiert entscheiden, Zeit nutzen, Qualität suchen
Vor einer Operation lohnt ein strukturiertes Vorgehen in mehreren Schritten. Bitte um eine leitlinienbasierte Begründung, die Befund, Symptomatik und den erwartbaren funktionellen Gewinn schlüssig verbindet. Verlange absolute Zahlen zu Nutzen, Risiken und Erholungszeit und kläre, was der beste konservative Plan in sechs bis zwölf Wochen leisten kann. Nutze dein Recht auf eine unabhängige Zweitmeinung und informiere dich über spezialisierte Häuser mit nachweislich guten Ergebnissen. Dokumentiere deinen Verlauf – Schmerzen, Funktion, Alltagsgrenzen, Training – und treffe deine Entscheidung auf Basis dieser Daten. Ein begründetes Ja zur OP ist dann ebenso stark wie ein begründetes Nein zugunsten einer klugen Alternative.
Schluss: Weniger Messer, mehr Maß
Deutschland verfügt über herausragende chirurgische Kompetenz. Was in Teilen fehlt, ist nicht Können, sondern die unbeirrbare Konsequenz, dieses Können nur dort einzusetzen, wo der Nutzen robust und persönlich bedeutsam ist. Der Weg dorthin ist klar: präzisere Diagnostik, konsequente konservative Pfade, ehrliche Risikokommunikation, Spezialisierung mit Transparenz, Qualität als Währung und eine Vergütung, die Ergebnisse statt Aktivitäten belohnt. Dann geht das Licht im OP-Saal genau dann an, wenn es wirklich nötig ist – und es bleibt aus, wenn Zeit, Training und Therapie das bessere Werkzeug sind. So entsteht Vertrauen: in Entscheidungen, in Strukturen und in eine Medizin, die Maß hält, weil sie kann.






