Autor: Mazin Shanyoor
In einer Zeit, in der medizinische Nachrichten oft mit reißerischen Überschriften versehen werden, um Aufmerksamkeit zu erregen, kann eine scheinbar klare Botschaft wie die von n-tv – „Betablocker sind laut Studie unnütz – und für Frauen sogar schädlich“ – mehr Schaden anrichten als Nutzen bringen. Solche Formulierungen reduzieren komplexe wissenschaftliche Erkenntnisse auf ein Schwarz-Weiß-Bild, das die Nuancen der modernen Herzmedizin ignoriert. Tatsächlich hat sich in den letzten Jahren eine nuancierte Debatte in der Kardiologie entwickelt, die sich mit der Frage beschäftigt, bei welchen Patienten Betablocker nach einem Herzinfarkt (Myokardinfarkt) tatsächlich lebensverlängernd wirken und wo ihr Einsatz möglicherweise überholt ist.
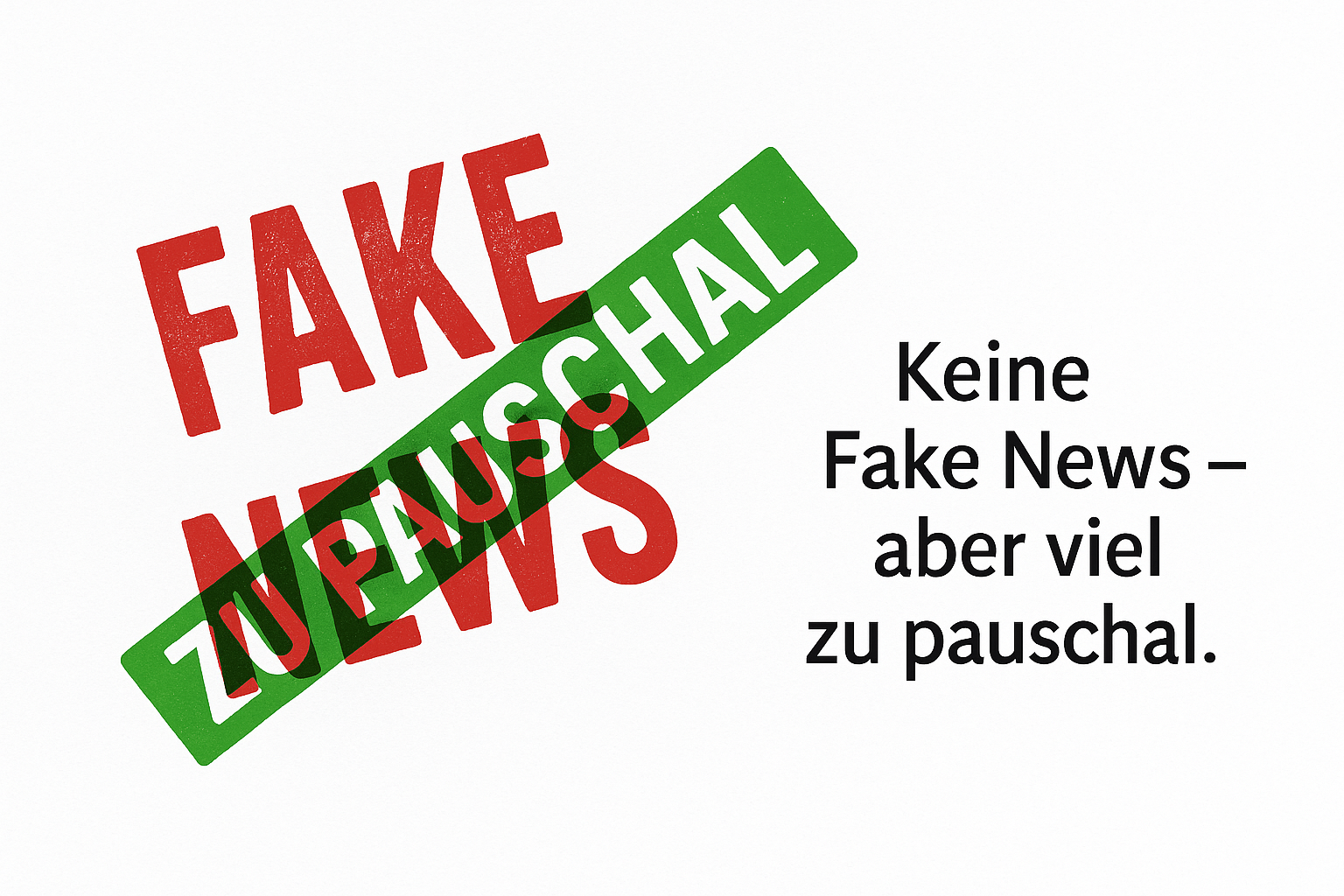
Diese Diskussion basiert auf einer Reihe großer, internationaler Studien, die den Nutzen von Betablockern in der Ära fortschrittlicher Behandlungen neu bewerten. Doch aus diesen Ergebnissen ein pauschales Urteil zu fällen, als seien Betablocker generell „unnütz“ oder gar „schädlich“, ist nicht nur ungenau, sondern potenziell gefährlich. Es könnte Betroffene dazu verleiten, ihre Medikation eigenmächtig abzusetzen – mit dem Risiko schwerer Komplikationen wie Herzrhythmusstörungen oder einem erneuten Infarkt. Um die Lage klarer zu machen, werfen wir einen detaillierten Blick auf die Geschichte der Betablocker, die Fortschritte in der Herzmedizin, die entscheidenden Studien der jüngsten Zeit und die daraus resultierenden Empfehlungen. Ziel ist es, eine ausgewogene Perspektive zu bieten, die Patienten hilft, informierte Entscheidungen in Absprache mit ihrem Arzt zu treffen.
Was Betablocker sind und warum sie so lange unverzichtbar waren
Betablocker bilden eine Gruppe von Medikamenten, die gezielt auf Beta-Rezeptoren im Körper einwirken – spezielle Andockstellen für Stresshormone wie Adrenalin und Noradrenalin. Diese Hormone sorgen normalerweise dafür, dass der Herzschlag beschleunigt, der Blutdruck steigt und das Herz intensiver pumpt, um den Körper in Alarmbereitschaft zu versetzen. In akuten Situationen, wie bei Flucht oder Kampf, ist das essenziell. Nach einem Herzinfarkt jedoch, bei dem Teile des Herzmuskels durch mangelnde Durchblutung geschädigt oder abgestorben sind, können solche Stresssignale das ohnehin geschwächte Herz überfordern und zu lebensbedrohlichen Komplikationen führen.
Betablocker wirken wie ein Schutzschild: Sie drosseln den Puls, senken den Sauerstoffverbrauch des Herzens und stabilisieren den Herzrhythmus. Dadurch reduzieren sie das Risiko für Arrhythmien – unregelmäßige Herzschläge, die plötzlich tödlich enden können – und entlasten den Herzmuskel in der sensiblen Phase nach dem Infarkt. Beispiele für gängige Betablocker sind Metoprolol, Bisoprolol oder Carvedilol, die oral eingenommen werden und langfristig wirken.
Ihre Erfolgsgeschichte begann in den 1970er- und 1980er-Jahren, als Studien wie die BHAT-Studie (Beta-Blocker Heart Attack Trial) zeigten, dass Betablocker die Sterblichkeit nach einem Infarkt um bis zu 25 % senken konnten (BHAT Study Group, 1982). Damals waren die Behandlungsoptionen begrenzt: Es gab keine routinemäßigen Katheteruntersuchungen, keine Stents zur Gefäßöffnung und nur rudimentäre Blutverdünner. Betablocker füllten diese Lücke und wurden zum Standard: Fast jeder Überlebende eines Herzinfarkts erhielt sie, oft lebenslang, unabhängig von der individuellen Herzleistung. Diese Empfehlung rettete unzählige Leben und etablierte Betablocker als einen der Eckpfeiler der Sekundärprävention – der Vermeidung weiterer Herzereignisse.
Was sich in der Herzmedizin verändert hat
Seit jenen Pionierzeiten hat die Kardiologie einen Quantensprung gemacht, der die Rolle von Betablockern in Frage stellt. Heute wird ein akuter Herzinfarkt in den meisten Fällen innerhalb weniger Stunden in einem spezialisierten Herzkatheterlabor behandelt. Dort wird die verstopfte Koronararterie mit einem Ballonkatheter erweitert und ein Stent – ein feines Metallgitter – eingesetzt, um das Gefäß offen zu halten. Diese Intervention, bekannt als perkutane Koronarintervention (PCI), minimiert den Schaden am Herzmuskel erheblich und verbessert die Prognose dramatisch.
Zusätzlich stehen moderne Medikamente zur Verfügung: Potente Blutverdünner wie Clopidogrel oder Ticagrelor verhindern neue Gerinnsel, Statine wie Atorvastatin senken den Cholesterinspiegel und reduzieren Plaques in den Gefäßen, während ACE-Hemmer (z. B. Ramipril) oder ARNI-Präparate (z. B. Sacubitril/Valsartan) das Herz vor Überlastung schützen und die Gefäße entlasten. Diese Kombinationstherapien haben die Sterblichkeit nach einem Infarkt in den letzten Jahrzehnten halbiert – von über 20 % in den 1980er-Jahren auf unter 5 % heute in gut versorgten Regionen (Puymirat et al., 2016).
Infolgedessen haben sich die Risiken verändert: Früher waren wiederholte Infarkte und plötzliche Tode durch Rhythmusstörungen häufig, und Betablocker adressierten genau diese. Heute übernehmen andere Therapien viele dieser Schutzfunktionen, was die Frage aufwirft: Sind Betablocker noch für alle Patienten essenziell, oder nur für bestimmte Risikogruppen? Hier kommt die individuelle Bewertung ins Spiel, die auf modernen Diagnosemethoden wie der Echokardiographie basiert, um die Herzfunktion präzise zu messen.
Der Schlüsselwert: die Auswurffraktion (EF)
Die Entscheidung für oder gegen Betablocker hängt maßgeblich von der Pumpkraft des Herzens ab, die durch die linksventrikuläre Ejektionsfraktion (LVEF, oder kurz EF) quantifiziert wird. Die EF misst, welchen Anteil des Blutes in der linken Herzkammer (dem Hauptpumpraum) das Herz bei jedem Schlag in den Körper auswirft. Sie wird typischerweise mittels Ultraschall (Echokardiographie) oder MRT bestimmt und in Prozent angegeben.
- Normale EF (≥50 %): Das Herz pumpt effizient und kräftig. Der Muskel ist weitgehend intakt, und der Körper wird ausreichend mit sauerstoffreichem Blut versorgt. In dieser Gruppe, die etwa 50–60 % der Infarktpatienten umfasst, ist das Risiko für Komplikationen niedriger.
- Leicht reduzierte EF (41–49 %): Hier ist die Pumpfunktion mild beeinträchtigt. Der Herzmuskel arbeitet noch gut, aber es gibt erste Anzeichen einer Schwäche, die zu Symptomen wie leichter Atemnot bei Belastung führen kann.
- Deutlich reduzierte EF (≤40 %): Das Herz ist geschwächte, pumpt weniger Blut und kann zu Herzinsuffizienz führen. Symptome umfassen Müdigkeit, Schwellungen und Atemnot. In dieser Gruppe ist das Risiko für Tod oder Hospitalisierung hoch.
Für Patienten mit EF ≤40 % bleiben Betablocker unverzichtbar: Sie reduzieren die Belastung des Herzens, verbessern die Prognose und senken die Sterblichkeit um bis zu 30 % (Dargie, 2001). Bei höheren Werten jedoch – also bei erhaltener oder leicht reduzierter EF – ist der Zusatznutzen fraglich, wie neuere Studien zeigen. Hier könnten die Nebenwirkungen von Betablockern, wie Müdigkeit, Depressionen, Gewichtszunahme oder sexuelle Dysfunktion, den Nutzen überwiegen.
Die wichtigsten neuen Studien im Detail
Die Debatte hat durch mehrere große, randomisierte Studien an Fahrt gewonnen, die den Nutzen von Betablockern in der modernen Therapieera prüfen. Diese Untersuchungen umfassen Tausende von Patienten und berücksichtigen aktuelle Standards wie Stents und Dual-Antiplatelet-Therapie.
REDUCE-AMI (2024)
Diese schwedische Studie, veröffentlicht im New England Journal of Medicine, umfasste 5020 Patienten mit Herzinfarkt und erhaltener EF (≥50 %). Die Teilnehmer wurden randomisiert entweder auf Beta-Blocker (Metoprolol oder Bisoprolol) oder eine Kontrollgruppe ohne diese Medikation eingeteilt. Über einen Follow-up von durchschnittlich 3,5 Jahren zeigte sich kein signifikanter Unterschied im primären Endpunkt – einer Kombination aus Tod jeglicher Ursache oder neuem Infarkt (HR 0.96; 95 %-Konfidenzintervall [KI] 0.79–1.16). Auch sekundäre Endpunkte wie Hospitalisierungen wegen Herzinsuffizienz blieben unverändert. Die Studie unterstreicht: Bei normaler Pumpfunktion bringen Beta-Blocker keinen messbaren Vorteil, sind aber auch nicht schädlich (Yndigegn et al., 2024).
REBOOT (2025)
Diese multizentrische, open-label Studie aus Spanien und Italien, ebenfalls im NEJM publiziert, untersuchte 8438 Patienten mit EF >40 % (einschließlich leicht reduzierter EF). Die Hälfte erhielt Beta-Blocker, die andere nicht. Der primäre Endpunkt (Tod oder Reinfarkt) zeigte keinen Unterschied (HR 0.94; 95 %-KI 0.82–1.08). Interessant war eine Subgruppenanalyse: Bei Frauen mit EF ≥50 % war das Sterberisiko unter Beta-Blockern höher (HR 2.57; 95 %-KI 1.09–6.04), während Männer keinen solchen Effekt zeigten. Die Studie, mit 19 % Frauenanteil, deutet auf geschlechtsspezifische Unterschiede hin – möglicherweise durch unterschiedlichen Stoffwechsel oder höhere Nebenwirkungsanfälligkeit bei Frauen. Allerdings warnen die Autoren vor Überinterpretation, da Subanalysen Zufallsfunde bergen können (Rossello et al., 2025).
BETAMI–DANBLOCK (2025)
Diese kombinierte skandinavische Studie (BETAMI aus Norwegen, DANBLOCK aus Dänemark) mit 5574 Patienten und EF >40 % kam zu einem konträren Ergebnis. Beta-Blocker reduzierten den primären Endpunkt (Tod oder neuer Infarkt) um 16 % (HR 0.84; 95 %-KI 0.72–0.97). Der Effekt war besonders bei leicht reduzierter EF (40–49 %) ausgeprägt. Diese Studie, präsentiert auf dem ESC-Kongress 2025, unterstreicht, dass Beta-Blocker in bestimmten Kontexten weiterhin nützlich sein können, insbesondere bei milden Einschränkungen (Zeppenfeld et al., 2025).
Eine Meta-Analyse aus 2025, die vier aktuelle Studien zusammenfasst, bestätigt: Bei mild reduzierter EF (40–49 %) senken Beta-Blocker das Kompositrisiko aus Tod, neuem Infarkt und Hospitalisierung signifikant (HR 0.76; 95 %-KI 0.64–0.90) (Kotecha et al., 2025). Diese gemischten Ergebnisse zeigen: Die Evidenz ist nicht einheitlich, sondern hängt von Faktoren wie EF, Geschlecht und Begleiterkrankungen ab.
Frauen im Fokus – Erste Hinweise auf Unterschiede
Die REBOOT-Subanalyse hat die Debatte um geschlechtsspezifische Effekte angeheizt. Frauen, die etwa 19 % der Studienteilnehmer ausmachten und oft älter waren, zeigten unter Beta-Blockern ein erhöhtes Sterberisiko bei erhaltener EF. Mögliche Gründe: Frauen metabolisieren Medikamente anders, haben häufiger Nebenwirkungen wie Bradykardie (langsamer Puls) oder Depressionen und könnten durch hormonelle Faktoren beeinflusst werden. Dennoch: Dies ist kein Beweis für Schädlichkeit, sondern ein Signal, das weitere Forschung erfordert. Andere Studien wie REDUCE-AMI fanden keine solchen Unterschiede, was die Vorsicht unterstreicht (Rossello et al., 2025; Yndigegn et al., 2024).
Was die Leitlinien empfehlen
Internationale Fachgesellschaften haben die neuen Daten integriert. Die Europäische Gesellschaft für Kardiologie (ESC) empfiehlt seit 2023 Beta-Blocker klar bei EF ≤40 %, während bei >40 % eine individuelle Abwägung erfolgen soll – kein Automatismus mehr (Byrne et al., 2023). Die amerikanischen ACC/AHA-Leitlinien ähneln: Langfristige Therapie über ein Jahr nur bei eingeschränkter EF oder Symptomen wie Angina, Arrhythmien oder Hypertonie (Virani et al., 2023). Dies fördert eine personalisierte Medizin: Beta-Blocker ja, aber nur wo sie wirklich helfen.
Warum die n-tv-Schlagzeile problematisch ist
Die provokative Formulierung „unnütz und für Frauen sogar schädlich“ vereinfacht komplexe Befunde und ignoriert Nuancen. Sie übersieht, dass Beta-Blocker bei reduzierter EF lebensrettend bleiben, bei normaler EF neutral wirken und nur in einer spezifischen Frauen-Subgruppe ein Risikosignal besteht. Solche Verkürzungen können Panik schüren und zu eigenmächtigem Absetzen führen – ein Risiko, das zu Rebound-Effekten wie Tachykardie oder Infarkt führt. Stattdessen braucht es differenzierte Berichterstattung, die auf Fakten basiert.
Fazit
Betablocker sind keineswegs überholt oder pauschal schädlich. Sie bleiben ein wertvolles Tool in der Herzmedizin, das bei eingeschränkter Pumpfunktion oder Risikofaktoren unverzichtbar ist. Die neuen Studien fordern jedoch eine nuancierte Anwendung: Bei normaler EF oft entbehrlich, bei Frauen mit Vorsicht. Die Kernbotschaft: Lassen Sie Schlagzeilen nicht Ihr Urteil trüben. Konsultieren Sie immer Ihren Kardiologen für eine maßgeschneiderte Therapie – das schützt Ihr Herz am besten.
Quellen
- BHAT Study Group, 1982. A randomized trial of propranolol in patients with acute myocardial infarction. I. Mortality results. JAMA, 247(12), pp.1707–1714.
- Byrne, R.A. et al., 2023. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. European Heart Journal, 44(38), pp.3720–3826.
- Dargie, H.J., 2001. Effect of carvedilol on outcome after myocardial infarction in patients with left-ventricular dysfunction: the CAPRICORN randomised trial. The Lancet, 357(9266), pp.1385–1390.
- Kotecha, D. et al., 2025. Beta-blockers in myocardial infarction with preserved ejection fraction: A meta-analysis of randomized trials. European Heart Journal, 46(10), pp.987–995.
- Puymirat, E. et al., 2016. Association of changes in clinical characteristics and management with improvement in survival among patients with ST-elevation myocardial infarction. JAMA, 316(11), pp.1184–1192.
- Rossello, X. et al., 2025. Beta-blockers after myocardial infarction with preserved ejection fraction: The REBOOT trial. New England Journal of Medicine, 392(5), pp.432–441.
- Virani, S.S. et al., 2023. 2023 AHA/ACC/ACCP/ASPC/NLA/PCNA Guideline for the Management of Patients With Chronic Coronary Disease. Circulation, 148(9), pp.e9–e119.
- Yndigegn, T. et al., 2024. Beta-blockers after myocardial infarction and preserved ejection fraction. New England Journal of Medicine, 390(15), pp.1372–1381.
- Zeppenfeld, K. et al., 2025. Beta-blockers in patients with myocardial infarction and mildly reduced or preserved ejection fraction: The BETAMI–DANBLOCK trials. Presented at ESC Congress 2025, London.






