Autor: Mazin Shanyoor
Wenn die Nieren plötzlich versagen, ist der gesamte Organismus bedroht. Die Nieren regulieren den Flüssigkeitshaushalt, kontrollieren lebenswichtige Elektrolyte, scheiden Giftstoffe aus, beeinflussen den Blutdruck und unterstützen die Bildung roter Blutkörperchen. Fällt diese Funktion aus, entstehen binnen kurzer Zeit lebensgefährliche Probleme: Wasser sammelt sich in Lunge und Gewebe, der Blutdruck entgleist, Giftstoffe überschwemmen den Körper und Elektrolyte wie Kalium steigen auf gefährliche Werte. Ein unbehandeltes Nierenversagen kann in Stunden zum Herzstillstand oder Multiorganversagen führen.
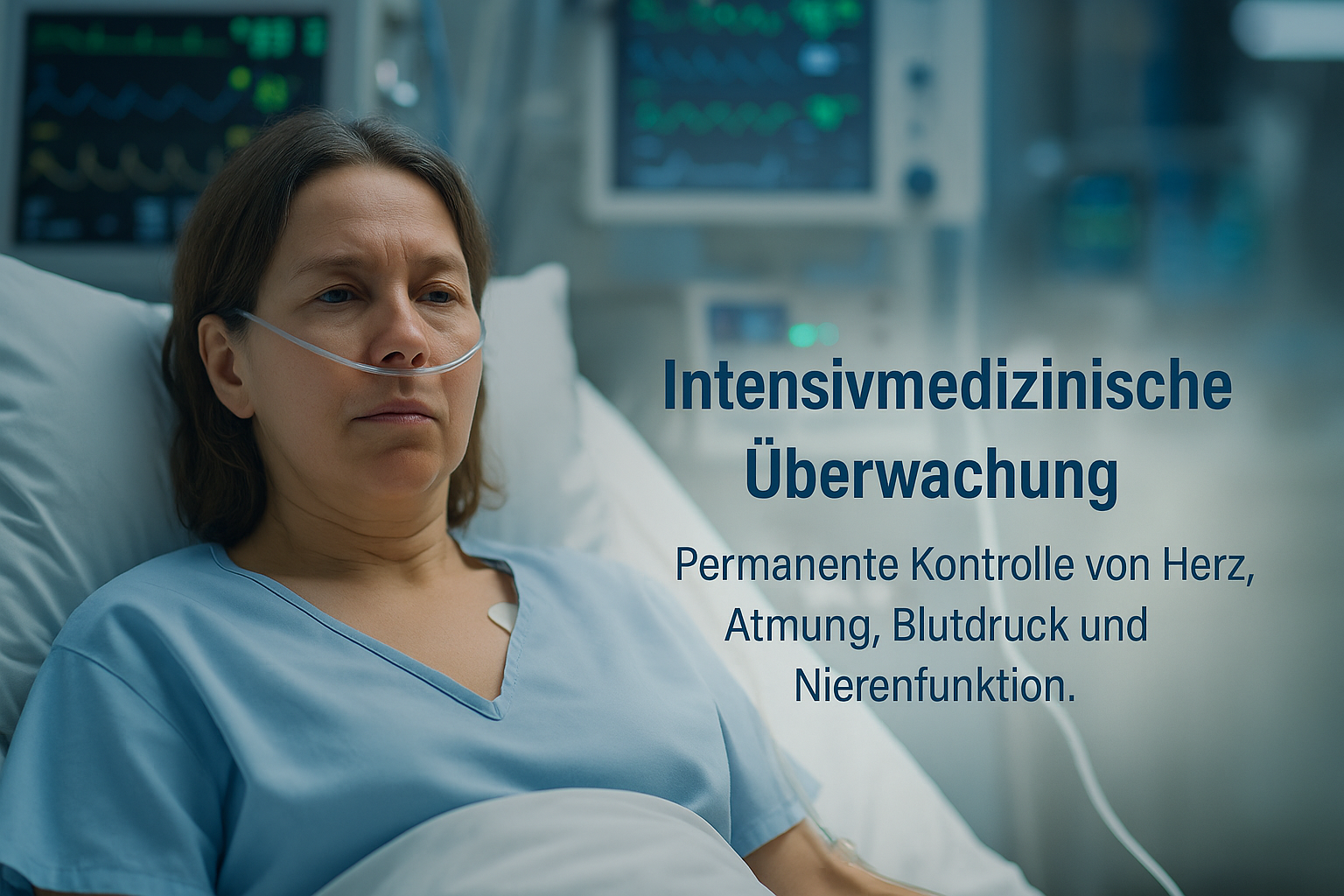
In schweren Verläufen ist die Intensivstation der richtige Ort: Dort können alle Körperfunktionen kontinuierlich überwacht und sofort therapiert werden. Die Intensivmedizin erfüllt drei Kernaufgaben:
- Kontinuierliche Überwachung aller lebenswichtigen Funktionen.
- Frühzeitige Erkennung von Komplikationen, noch bevor sie lebensbedrohlich werden.
- Aktive Stabilisierung durch Medikamente, Dialyse, Beatmung und weitere Maßnahmen.
Überwachung – was auf der Intensivstation kontrolliert wird
Herzrhythmus
Ein erhöhter Kaliumspiegel verändert die elektrische Aktivität des Herzens. Schon geringe Anstiege können EKG-Veränderungen (spitze T-Wellen, QRS-Verbreiterung) und gefährliche Rhythmusstörungen bis hin zu Kammerflimmern auslösen. Daher überwachen Monitore den Herzrhythmus permanent. Bei Abweichungen kann sofort mit Elektrolyttherapie, Antiarrhythmika oder – im Notfall – Defibrillation reagiert werden.
Blutdruck
Nierenversagen führt zu stark schwankenden Blutdruckwerten: Überwässerung begünstigt Hochdruck, Sepsis oder Herzschwäche können einen Schock mit sehr niedrigem Blutdruck auslösen. Auf der Intensivstation erfolgt die Messung häufig invasiv über einen Arterienkatheter (Beat-to-Beat-Messung), sodass schon kleinste Veränderungen erkannt und mit Infusionen, Vasopressoren oder Antihypertensiva sofort behandelt werden.
Sauerstoffsättigung und Atmung
Ein Lungenödem ist eine gefürchtete Komplikation. Noch bevor Atemnot entsteht, sinkt die Sauerstoffsättigung. Ein Pulsoximeter misst kontinuierlich, Blutgasanalysen liefern präzise Daten zu Sauerstoff, Kohlendioxid und pH-Wert. Abhängig vom Befund werden Sauerstoffgabe, nicht-invasive Beatmung (z. B. CPAP/High-Flow) oder invasive Beatmung eingeleitet.
Urinausscheidung
Die Urinmenge ist ein unmittelbarer Indikator der Restfunktion. Über Blasenkatheter wird stündlich millilitergenau gemessen. Oligurie (< 500 ml/24 h) oder Anurie (nahezu kein Urin) sind Alarmsignale und beeinflussen die Entscheidung für Dialyse, Flüssigkeitsmanagement und Medikamentendosen.
Blutwerte und Laborparameter
Mehrmals täglich (bei kritischen Verläufen auch stündlich) werden Blutproben analysiert: Kreatinin, Harnstoff (Entgiftungsstatus), Elektrolyte (Kalium, Natrium, Kalzium, Phosphat), Blutgase/pH (Säure-Basen-Haushalt), Entzündungsparameter (CRP, Leukozyten, Procalcitonin), Gerinnung und Blutbild. Diese Daten steuern alle Akutmaßnahmen – von Elektrolytkorrektur über Dialyse bis zur Antibiotikatherapie.
Neurologische Überwachung
Urämische Toxine belasten das Gehirn. Bewusstseinslage (z. B. Glasgow-Coma-Scale), Pupillenreaktion, motorische Antworten und ggf. EEG werden überwacht. Ziel ist, Verwirrtheit, Delir und Anfallsereignisse früh zu erkennen und durch rasche Entgiftung (Dialyse), Medikamentenanpassungen und Reorientierungsmaßnahmen zu behandeln.
Typische Komplikationen – und wie sie verhindert werden
Herzstillstand (Hyperkaliämie/Rhythmusstörungen)
Ein starker Kaliumanstieg kann das Herz in Sekunden zum Stillstand bringen. Kontinuierliches EKG, sofortige Kaliumsenkung (Insulin-Glukose-Schema, Calcium zur Membranstabilisierung, Ionenaustauscher) und ggf. Notfalldialyse senken das Risiko entscheidend.
Lungenödem
Flüssigkeit in den Alveolen verursacht hypoxische Atemnot. Frühzeichen sind fallende SpO2 und Rasselgeräusche. Therapie: streng gesteuerter Flüssigkeitsentzug (Dialyse/Ultrafiltration), Diuretika in ausgewählten Situationen, PEEP-Beatmung und Sauerstoffgabe.
Blutdruckkrisen
Hypertensive Entgleisungen schädigen Herz und Gehirn, Hypotonie gefährdet die Organperfusion. Invasive Druckmessung erlaubt minutenschnelle Anpassung von Vasopressoren/Antihypertensiva und Volumentherapie.
Schwere Elektrolytentgleisungen
Kalium, Natrium, Kalzium und Phosphat müssen engmaschig korrigiert werden. Ziel ist, kardiale und neuromuskuläre Komplikationen zu verhindern und die Korrekturgeschwindigkeit so zu wählen, dass keine osmotischen Schäden auftreten.
Urämische Enzephalopathie
Toxidrome reichen von Kopfschmerz und Konzentrationsstörung bis zu Krampfanfall und Koma. Rasche Entgiftung (Dialyse), Delir-Prävention, schrittweise Reorientierung und Schonung sedierender Substanzen sind zentral.
Multiorganversagen
Nierenversagen tritt häufig im Verbund mit Herz-, Lungen- oder Leberversagen auf. Die Intensivmedizin koordiniert Organunterstützung parallel (Beatmung, Dialyse, Kreislaufunterstützung), um die Überlebenschance zu erhöhen.
Behandlung auf der Intensivstation
Medikamente
Zielgerichtete Infusionen und Arzneimittel korrigieren Elektrolyte (z. B. Insulin/Glukose, Calcium, Ionenaustauscher), stabilisieren den Blutdruck (Vasopressoren/Antihypertensiva), schützen das Herz (Antiarrhythmika) und behandeln Infektionen (Antibiotika).
Atemunterstützung
Das Spektrum reicht von Sauerstoff über High-Flow und nicht-invasiver Ventilation (CPAP/BiPAP) bis zur invasiven Beatmung. Bei Lungenödem wird häufig mit PEEP gearbeitet, um alveoläre Flüssigkeit zu verdrängen und den Gasaustausch zu verbessern.
Kreislaufunterstützung
Eng geführte Volumentherapie, Vasopressoren und Inotropika sichern die Organperfusion. In Extremfällen kommen extrakorporale Unterstützungssysteme (z. B. ECMO) zum Einsatz.
Pflegerische Intensivmaßnahmen
Präzise Flüssigkeitsbilanz, Lagerung zur Dekubitus- und Pneumonieprophylaxe, Katheter- und Hautpflege, Mundhygiene, Schmerz- und Delirmanagement sowie empathische Kommunikation mit Patient:innen und Angehörigen sind tragende Säulen.
Dialyse – wenn die Maschine die Arbeit der Nieren übernimmt
Die Dialyse ist das Herzstück der Therapie bei schwerem Nierenversagen, wenn die Niere ihre Aufgaben nicht mehr erfüllt. Sie entfernt Giftstoffe, reguliert Elektrolyte und entzieht überschüssige Flüssigkeit. Das Verfahren wird abhängig von Kreislaufstabilität, Zielsetzung (rasche Entgiftung vs. schonender Dauerentzug) und technischen Ressourcen gewählt.
Hämodialyse (intermittierend)
Blut wird über einen großlumigen Venenkatheter (z. B. V. jugularis interna) zur Dialysemaschine geleitet, passiert eine semipermeable Membran und fließt gereinigt zurück. Durch Diffusion werden Harnstoff, Kreatinin und andere Toxine entfernt; durch Ultrafiltration wird Flüssigkeit entzogen; die Dialysierflüssigkeit stellt das Elektrolytgleichgewicht ein.
- Vorteil: sehr effektive, rasche Entgiftung und Flüssigkeitsentfernung innerhalb von 3–5 Stunden.
- Nachteil: Kreislaufbelastung (rascher Volumenentzug), daher für instabile Patient:innen oft ungeeignet.
Kontinuierliche Verfahren (CRRT: CVVH, CVVHD, CVVHDF)
Bei kritisch Kranken werden kontinuierliche Nierenersatzverfahren bevorzugt. Das Blut wird langsam, aber ununterbrochen (24/7) über einen Filter geführt. Konvektion (Hämofiltration) entfernt vor allem mittelmolekulare Toxine über Filtration, Diffusion (Hämodialyse) entfernt kleine Moleküle über Konzentrationsgefälle; Hämodiafiltration kombiniert beide Prinzipien.
- Vorteile: hohe hämodynamische Stabilität, fein steuerbarer Flüssigkeitsentzug, gleichmäßige Entgiftung.
- Nachteile: hoher technischer/pflegerischer Aufwand, kontinuierliche Antikoagulation, Filter-/Katheterprobleme möglich.
Peritonealdialyse (selten auf ICU)
Die Bauchhöhle dient als natürliche Membran: Dialysat wird über einen Peritonealkatheter eingebracht, Toxine diffundieren in die Lösung, die nach Verweildauer wieder abgelassen wird. Vorteile sind Unabhängigkeit von extrakorporalen Kreisläufen; bei kritisch Kranken jedoch wegen geringerer Effizienz und Infektionsrisiko seltener eingesetzt.
Gefäßzugang und Antikoagulation
Für Hämo- und Hämofiltrationsverfahren sind großlumige, doppellumige Katheter in zentralen Venen notwendig (z. B. V. jugularis interna, V. femoralis). Aseptische Technik und sorgfältige Katheterpflege minimieren Infektionsrisiken. Eine Antikoagulation (Heparin oder regionale Zitratantikoagulation) verhindert Filtergerinnung; Dosierung wird an Blutungsrisiko und Leberfunktion angepasst.
Therapieziele und Steuerung
Ziele sind: Urämietoxin-Reduktion, Hyperkaliämie-Kontrolle, Korrektur der Azidose und präziser Flüssigkeitsentzug. Die Einstellungen (Dialysat-/Ersatzfluss, Ultrafiltrationsrate, Natrium/Kalium im Dialysat) werden anhand von Labor, Hämodynamik, Lungenstatus und Urinmenge fortlaufend angepasst.
Mögliche Komplikationen der Dialyse
- Hypotonie: Blutdruckabfall bei zu schnellem Volumenentzug; Gegenmaßnahmen: Rate senken, Volumenbolus, Vasopressor.
- Elektrolyt-Fehlkorrektur: zu rasche Natrium-/Kaliumänderungen; erfordern behutsame Anpassungen.
- Filter-/Katheterprobleme: Gerinnsel, Fehlfunktion; ggf. Wechsel nötig.
- Infektionen: Katheter-assoziierte Bakteriämien; Prophylaxe durch sterile Technik und kurze Katheterliegedauer.
- Krampfanfälle/Delir: selten, bei rascher Urämie-Korrektur; enges Monitoring notwendig.
Wie Patient:innen die Dialyse erleben
Für viele ist es ein Einschnitt, wenn eine Maschine die Nierenfunktion übernimmt. Müdigkeit, Frösteln oder Muskelkrämpfe können auftreten. Aufklärung, behutsame Einstellungen, wärmende Maßnahmen und kontinuierliche Begleitung durch Pflege und Ärzteteam helfen, die Behandlung erträglich und sicher zu gestalten.
Alltag auf der Intensivstation
Die Intensivstation ist eine technikreiche Umgebung mit Monitoren, Infusionspumpen und Alarmen. Viele Patient:innen erinnern sich später nur bruchstückhaft (Delirrisiko). Strukturierte Tagesabläufe, Reorientierung, Tageslicht, Hör-/Sehhilfen, Angehörigenkontakt und ruhige Kommunikation reduzieren Belastungen.
Interdisziplinäre Zusammenarbeit
Versorgung ist Teamarbeit: Intensivmediziner:innen (Koordination), Nephrolog:innen (Dialyse/Nierenstrategie), Kardiolog:innen (Herz), Pneumolog:innen/Anästhesist:innen (Atmung), Mikrobiolog:innen (Infektionen), Intensivpflege (24/7-Betreuung), Ernährungsberatung, Physiotherapie und Psychologie arbeiten eng verzahnt.
Prognose
Die Aussichten hängen ab von Ursache (reversibel vs. struktureller Schaden), Dauer bis zur Intensivtherapie, Alter, Vorerkrankungen und Komplikationen (Sepsis, Multiorganversagen). Viele erholen sich komplett; andere behalten eine eingeschränkte Nierenfunktion oder benötigen längerfristig Dialyse. Frühzeitige intensivmedizinische Maßnahmen verbessern die Überlebenschancen signifikant.
Fazit
Die intensivmedizinische Überwachung bei Nierenversagen ist eine lebensrettende Kombination aus kontinuierlichem Monitoring, vorausschauender Komplikationsprävention und aktiver Therapie. Besonders die Dialyse übernimmt die zentrale Rolle, wenn die Niere ausfällt: Sie entgiftet, steuert Elektrolyte und entzieht überschüssiges Wasser – schonend oder rasch, je nach Verfahren. Für Patient:innen ist die Zeit auf der Intensivstation belastend, für Angehörige herausfordernd; zugleich ist sie der sicherste Ort, an dem moderne Medizin und menschliche Zuwendung zusammenkommen, um Stabilität zu schaffen und den Nieren Zeit zur Erholung zu geben.






