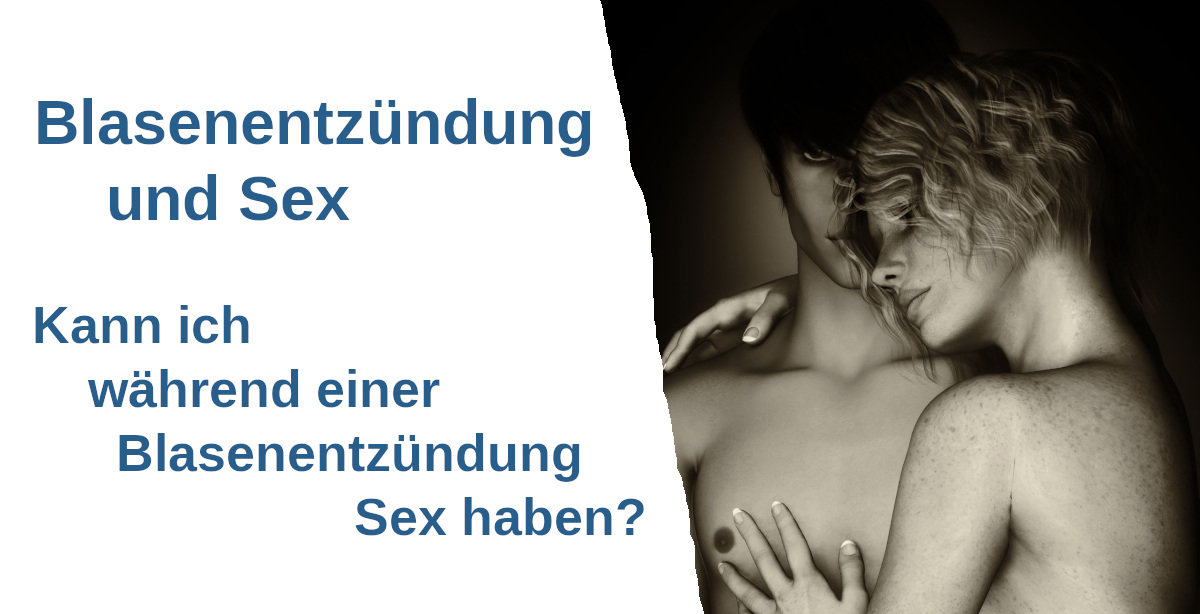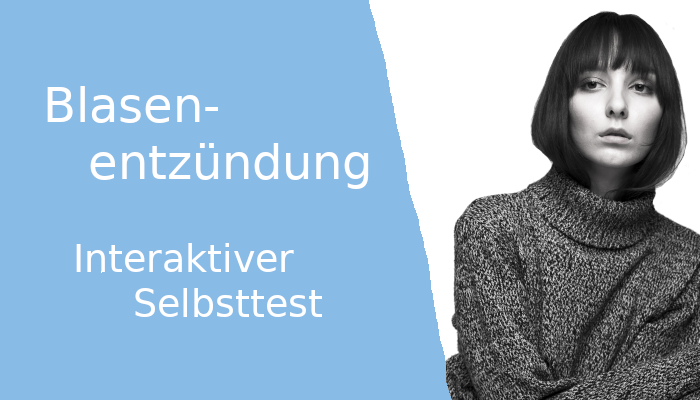Autor: Mazin Shanyoor
Der Begriff "Honeymoon-Zystitis" stammt aus dem Englischen und bedeutet übersetzt "Flitterwochen-Blasenentzündung". Diese spezielle Form der Blasenentzündung erhielt ihren Namen zu Beginn des 20. Jahrhunderts, als es nicht unüblich war, dass Frauen mit dem ersten Geschlechtsverkehr bis zur Hochzeitsnacht warteten. Auffällig war, dass in der Zeit unmittelbar nach der Heirat die Zahl der Blasenentzündungen (Harnwegsinfekte) bei frisch verheirateten Frauen deutlich anstieg.
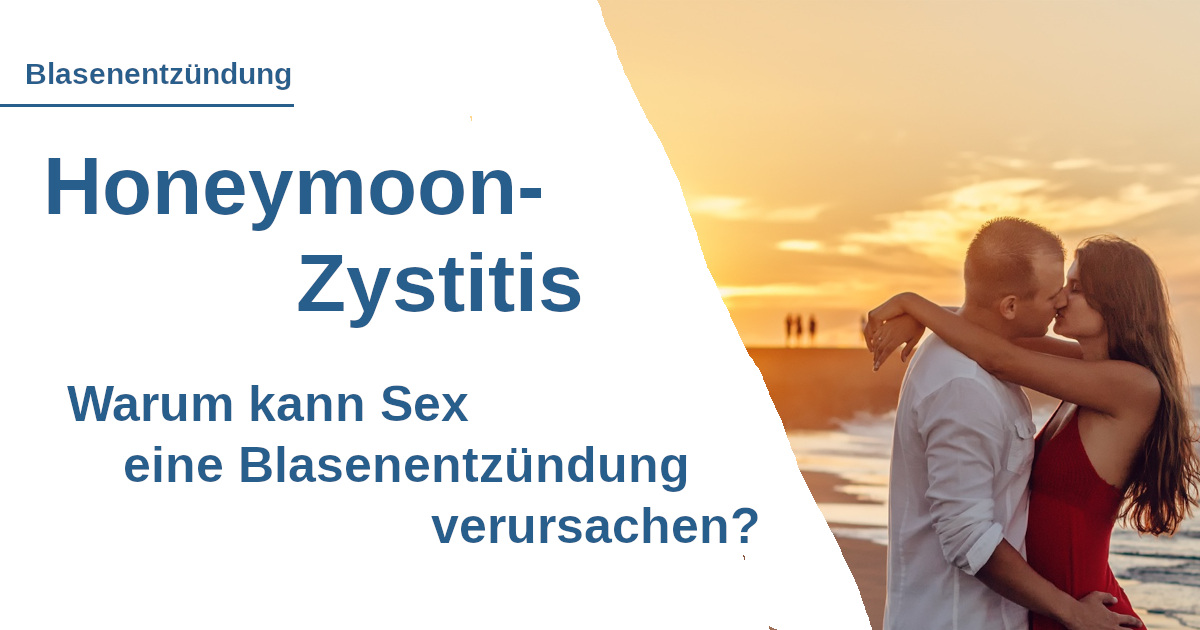
Blasenentzündung im Schatten der Leidenschaft
Sexuelle Aktivität als Auslöser
Heute wird die Honeymoon-Zystitis mit einer akuten Blasenentzündung gleichgesetzt, die in direktem Zusammenhang mit sexueller Aktivität steht. Obwohl die Symptome - wie häufiger Harndrang, Brennen beim Wasserlassen, Krämpfe und Schmerzen im Unterleib - denen einer herkömmlichen Blasenentzündung ähneln, fällt auf, dass die Beschwerden oft unmittelbar nach dem Geschlechtsverkehr beginnen. Dies deutet auf einen eindeutigen Zusammenhang zwischen sexueller Aktivität und der Entstehung einer akuten Blasenentzündung hin.
Mythos entlarvt: Sind Männer und ihr Sperma an Blasenentzündungen schuld?
Die Wahrheit über Sperma und Zystitis
Über die Ursachen von Blasenentzündungen kursieren viele Mythen und Halbwahrheiten. Eine davon betrifft die Rolle des männlichen Partners und insbesondere seines Spermas. Doch was ist dran an dieser Annahme? Verursacht das Sperma oder der Sexualpartner selbst eine Blasenentzündung?
Entgegen der landläufigen Meinung ist das Sperma nicht direkt für die Entstehung einer Blasenentzündung verantwortlich. Auch der Geschlechtspartner ist in den meisten Fällen nicht die Ursache der Infektion. Vielmehr entstehen Blasenentzündungen häufig durch die Übertragung von Darmbakterien in den Urogenitaltrakt, was durch den Geschlechtsverkehr selbst begünstigt werden kann. Die Nähe von Darmausgang und weiblichem Intimbereich erleichtert es den Bakterien, in die Harnröhre zu gelangen und dort eine Infektion auszulösen.
Kein Zusammenhang zwischen Sperma und Blasenentzündung
Die Annahme, dass Männer oder ihr Sperma direkt für Blasenentzündungen verantwortlich sind, hält einer wissenschaftlichen Überprüfung nicht stand. Sexuelle Aktivität kann zwar das Risiko einer Übertragung von Bakterien erhöhen, aber es sind nicht das Sperma oder der Partner selbst, die eine Blasenentzündung verursachen. Vielmehr sind ein bewusster Umgang mit der eigenen Körperhygiene und Aufmerksamkeit bei zusätzlichen Symptomen entscheidend, um das Risiko einer Blasenentzündung oder einer sexuell übertragbaren Krankheit zu minimieren.
Risikofaktoren und Erklärungsansätze für die Honeymoon-Zystitis
Obwohl oft missverstanden, ist die Honeymoon-Zystitis keine Erkrankung, die direkt durch sexuell übertragbare Erreger verursacht wird. Entscheidend für das Verständnis dieser Art von Blasenentzündung ist die Rolle der eigenen Darmflora. Die anatomische Nähe zwischen dem Darmausgang und dem weiblichen Urogenitaltrakt begünstigt beim Geschlechtsverkehr den Übertritt von Darmbakterien, vor allem E. coli, in die Harnröhre.
Die Mechanik des Geschlechtsverkehrs selbst spielt eine wichtige Rolle bei der Förderung dieses Prozesses. Insbesondere intensive und häufige sexuelle Aktivität kann die Übertragung von Bakterien in die Harnröhre begünstigen. Die Bewegungen während des Geschlechtsverkehrs können zu einer mechanischen Verschiebung und damit zu einer erhöhten Exposition der Harnröhrenöffnung gegenüber diesen Bakterien führen.
Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass eine erhöhte Hygiene im Intimbereich oder das Waschen unmittelbar vor oder nach dem Geschlechtsverkehr das Risiko einer solchen Infektion verringern kann.
Tatsächlich kann eine übertriebene oder falsche Intimhygiene das Risiko sogar erhöhen, da sie die natürliche Schutzbarriere der Schleimhäute schwächt und das mikrobielle Gleichgewicht der Scheidenflora stört.
Ein weiterer Risikofaktor ist die Anwendung bestimmter Verhütungsmethoden. Spermizide, die in Kombination mit Diaphragmen oder Kondomen verwendet werden, können die Scheidenflora ebenfalls negativ beeinflussen und somit das Risiko einer Honeymoon-Zystitis erhöhen.
Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren
Die Honeymoon-Zystitis ist ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Faktoren, bei dem die Übertragung von Darmbakterien in den Urogenitaltrakt im Mittelpunkt steht. Die Intensität und Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs sowie individuelle anatomische Gegebenheiten und der Zustand der vaginalen Mikroflora beeinflussen das Risiko, an dieser Form der Blasenentzündung zu erkranken, maßgeblich. Das Bewusstsein für diese Risikofaktoren und eine entsprechende Körperhygiene sind entscheidend, um das Auftreten einer Honeymoon-Zystitis zu minimieren.
Interessanterweise kann auch ein neuer Sexualpartner das Risiko einer Blasenentzündung vorübergehend erhöhen, da sich das Immunsystem der Frau erst an die neue Bakterienflora anpassen muss. Mit der Zeit und der Gewöhnung an die neuen Bakterien sollte das Risiko einer Honeymoon-Blasenentzündung abnehmen.
Vorbeugung und Maßnahmen
Trotz des erhöhten Risikos müssen betroffene Frauen nicht auf ein erfülltes Sexualleben verzichten. Einfache vorbeugende Maßnahmen können helfen, das Risiko einer Honeymoon-Zystitis zu minimieren. So ist es ratsam, die Blase nach dem Geschlechtsverkehr zu entleeren, um mögliche Bakterien auszuspülen. Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr vor dem Geschlechtsverkehr unterstützt diesen Prozess.
Meine Meinung
Die Honeymoon-Zystitis unterstreicht die Bedeutung eines bewussten Umgangs mit dem eigenen Körper und der persönlichen Hygiene, insbesondere im Zusammenhang mit sexueller Aktivität. Wer die Ursachen kennt und einfache vorbeugende Maßnahmen ergreift, kann das Risiko einer Blasenentzündung wirksam verringern, ohne auf die Freuden des Liebeslebens verzichten zu müssen. Die Behandlung der Honeymoon-Zystitis folgt den üblichen Therapieansätzen bei unkomplizierten Harnwegsinfektionen, wobei eine frühzeitige Intervention entscheidend ist, um Komplikationen zu vermeiden und eine rasche Genesung zu fördern.
Quellen, Leitinien & Studien
- Deutsche Gesellschaft für Urologie (DGU). Interdisziplinäre S3 Leitlinie: Epidemiologie, Diagnostik, Therapie, Prävention und Management unkomplizierter, bakterieller, ambulant erworbener Harnwegsinfektionen bei erwachsenen Patienten. Update 2017. AWMF-Registernr.: 043-044. April 2017
- Schmelz HU, Sparwasser C, Weidner W. Facharztwissen Urologie (2006). Herausgeber: Springer Berlin, Heidelberg . DOI: https://doi.org/10.1007/3-540-32986-2.
- Bishop, B., Duncan, M., Song, J. et al. Cyclic AMP–regulated exocytosis of Escherichia coli from infected bladder epithelial cells. Nat Med 13, 625–630 (2007). https://doi.org/10.1038/nm1572
- Wagenlehner, F.M. et al. Non-Antibiotic Herbal Therapy (BNO 1045) versus Antibiotic Therapy (Fosfomycin Trometamol) for the Treatment of Acute Lower Uncomplicated Urinary Tract Infections in Women: A Double-Blind, Parallel-Group, Randomized, Multicentre, Non-Inferiority Phase III Trial. Urol Int 31 October 2018; 101 (3): 327–336. https://doi.org/10.1159/000493368
- "Deep insights into urinary tract infections and effective natural remedies." African Journal of Urology, vol. 26, no. 1, 2020. https://afju.springeropen.com/
- "Natural therapeutics for urinary tract infections—a review." Future Journal of Pharmaceutical Sciences, vol. 6, no. 1, 2020. https://fjps.springeropen.com/articles/10.1186/s43094-020-00086-2 - Tache, A.M., Dinu, L.D., & Vamanu, E. "Novel Insights on Plant Extracts to Prevent and Treat Recurrent Urinary Tract Infections." Applied Sciences, vol. 12, no. 5, 2022, p. 2635. https://www.mdpi.com/
- "Evidence-Based Review on the Effect of Natural Compounds on SARS-CoV-2 (COVID-19) Based on Molecular Docking Studies." Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2021, Article ID 7341124, 2021. https://www.hindawi.com/
Verwandte Beiträge
Eine der häufigsten Fragen im Zusammenhang mit einer akuten Blasenentzündung lautet: Darf ich während dieser Zeit Sex haben?
Klare Antwort: Nein, besser nicht!