Autor: Mazin Shanyoor
Belastend, aber oft unerkannt - die unsichtbare Herausforderung und wie erkenne ich, ob ich einen Hashimoto-Schub habe?
Ein Hashimoto-Schub kann den Alltag unvermittelt und auf vielfältige Weise erschweren. Plötzliche Erschöpfung, die selbst nach ausreichendem Schlaf nicht vergeht, ein unerklärlicher Anstieg des Körpergewichts, empfindliche Reaktionen auf Kälte oder anhaltende Verdauungsprobleme sind nur einige der Symptome, die auftreten können. Dazu gesellen sich oft kognitive Einschränkungen wie Konzentrationsschwierigkeiten oder das Gefühl, geistig "neben der Spur" zu sein. Auch Stimmungsschwankungen, Depressionen und ein verstärktes Angstempfinden machen einen Schub zu einer belastenden Erfahrung. Gleichzeitig bleibt die Haut trocken, die Haare fallen aus oder verändern ihre Struktur, und selbst Muskelschmerzen können zum täglichen Begleiter werden.
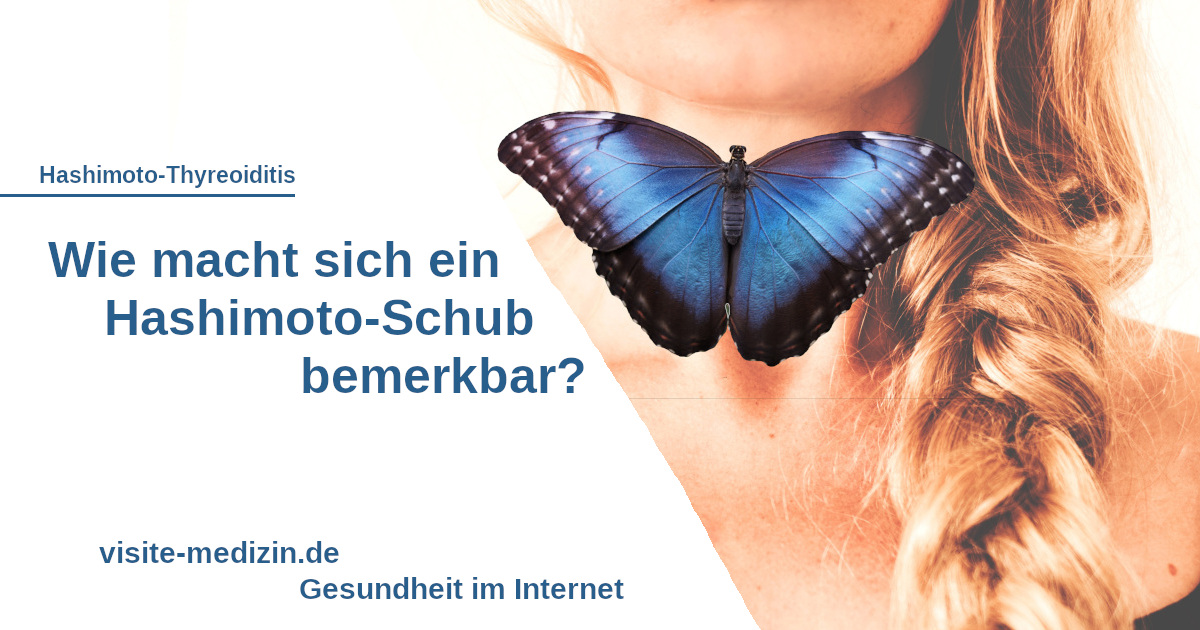
So individuell wie die Symptome eines Hashimoto-Schubs sind, so schwer lässt sich dieser oft erkennen. Die Erkrankung, eine chronische Autoimmunstörung der Schilddrüse, bringt das körpereigene Gleichgewicht aus dem Takt. Während die Phasen relativer Stabilität es den Betroffenen erlauben, sich an eine neue Normalität zu gewöhnen, reißt ein Schub diese vermeintliche Ordnung abrupt ein. Der Stoffwechsel wird ausgebremst, der Hormonhaushalt gerät ins Wanken, und die körperlichen wie emotionalen Auswirkungen können überwältigend sein.
Das tückische an Hashimoto-Schüben ist jedoch nicht nur ihre Vielgestaltigkeit, sondern auch die Unsichtbarkeit ihrer Ursache. Für Außenstehende wirken die Beschwerden oft unauffällig oder werden missverstanden, selbst Ärzte übersehen Schübe mitunter, wenn die Symptome zu diffus erscheinen. Genau deshalb ist es so wichtig, die verschiedenen Erscheinungsformen eines Hashimoto-Schubs zu kennen, um die Krankheit besser zu verstehen und angemessen darauf reagieren zu können.
Auffällige Symptome bei einem Hashimoto-Schub
Ein Hashimoto-Schub äußert sich oft in einer deutlichen Verschlechterung des Wohlbefindens und einer Vielzahl von Symptomen, die die körperliche und emotionale Balance empfindlich stören können. Eines der häufigsten und belastendsten Anzeichen ist eine ausgeprägte Erschöpfung, die Betroffene trotz ausreichendem Schlaf oder Ruhepausen überwältigt. Diese Müdigkeit ist nicht vergleichbar mit einer normalen Tagesmüdigkeit, sondern so tiefgreifend, dass sie alltägliche Aktivitäten erheblich einschränken und das Leben schwer planbar machen kann. Hinzu kommt häufig eine unerklärliche Gewichtszunahme. Da die Schilddrüse eine zentrale Rolle im Stoffwechsel einnimmt, führt ihre eingeschränkte Funktion während eines Schubs zu einer verlangsamten Stoffwechselrate, die eine Zunahme des Körpergewichts begünstigt, selbst wenn die Ernährung unverändert bleibt.
Ein weiteres charakteristisches Symptom ist die erhöhte Kälteempfindlichkeit. Betroffene fühlen sich selbst in gut beheizten Räumen frierend oder bemerken, dass sie deutlich empfindlicher auf kühlere Temperaturen reagieren. Diese Störung des Wärmehaushalts des Körpers verstärkt das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Auch die Verdauung kann beeinträchtigt sein: Verstopfung ist ein häufiges Problem, das durch die allgemeine Verlangsamung der körperlichen Prozesse noch verstärkt wird und die Lebensqualität zusätzlich mindert.
Die psychischen Auswirkungen eines Hashimoto-Schubs sind ebenso bedeutend wie die körperlichen. Stimmungsschwankungen treten häufig auf, wobei viele Betroffene von verstärkten depressiven Phasen oder einem intensiveren Angstempfinden berichten. Diese Veränderungen können das soziale Leben und die persönliche Belastbarkeit stark beeinträchtigen. Gleichzeitig können sich Veränderungen an Haut und Haaren zeigen. Viele Menschen klagen über trockene, raue Haut, die an Elastizität verliert, sowie über Haarausfall oder eine Veränderung der Haarstruktur, was das äußere Erscheinungsbild und das Selbstwertgefühl zusätzlich belasten kann.
Auch Schmerzen und Bewegungseinschränkungen gehören zu den häufigen Begleiterscheinungen eines Schubs. Muskelschmerzen, Steifheit oder eine allgemeine Schwäche der Muskulatur und der Gelenke machen den Körper schwerfällig und führen oft zu weiteren Einschränkungen im Alltag. Frauen können zudem Veränderungen im Menstruationszyklus feststellen. Unregelmäßigkeiten oder das Ausbleiben der Periode sind häufige Beschwerden, die zusätzlich zu den körperlichen und emotionalen Belastungen auftreten.
Hinzu kommen oft kognitive Probleme, die den Alltag weiter erschweren. Schwierigkeiten mit der Konzentration, Gedächtnislücken oder ein generelles Gefühl, geistig nicht klar denken zu können, sind typische Beschwerden. Dieses Phänomen, häufig als „Brain Fog“ bezeichnet, verstärkt das Gefühl von Kontrollverlust und beeinträchtigt die mentale Leistungsfähigkeit. In einigen Fällen können sich die Symptome auch auf das Herz-Kreislauf-System ausweiten. Herzklopfen oder Herzrhythmusstörungen treten auf und erhöhen den Druck auf die Betroffenen, schnell ärztliche Hilfe zu suchen.
Die Herausforderung bei der Erkennung eines Hashimoto-Schubs liegt in der Vielfalt und Unspezifität der Symptome. Da die Beschwerden sehr individuell sind und sich in ihrer Intensität und Ausprägung stark unterscheiden können, werden sie sowohl von Betroffenen selbst als auch von medizinischem Fachpersonal oft nicht unmittelbar mit einem Schub in Verbindung gebracht. Dies führt zu einem hohen Leidensdruck, da die Ursache der Beschwerden zunächst unklar bleibt und die Symptome nicht gezielt behandelt werden.
Die richtige Therapie setzt daher eine genaue Beobachtung und Anpassung der Schilddrüsenhormonmedikation voraus. Eine enge Zusammenarbeit mit dem behandelnden Arzt ist essenziell, um die Symptome zu lindern und die Lebensqualität langfristig zu verbessern. Nur durch ein umfassendes Verständnis der Erkrankung können Betroffene und Ärzte gemeinsam Strategien entwickeln, um die Belastungen eines Hashimoto-Schubs zu reduzieren.
Quellen, Leitinien & Studien
Deutsche Gesellschaft für Endokrinologie: Hashimoto-Thyreoiditis - Ratgeber, unter: www.endokrinologie.net (Abrufdatum am 10.08.2023)
Hoffmann, G.F.: Stoffwechselerkrankungen in der Neurologie, Georg Thieme Verlag, 2004
Prinz, C.: Basiswissen Innere Medizin, Springer Verlag, 2012
Rinninger, F. et al.: Innere Medizin, Georg Thieme Verlag, 2010






