Es geschieht oft in einem Moment völliger Ruhe: Man sitzt auf dem Sofa, liest vielleicht ein Buch oder schaut fern, und plötzlich beginnt das Herz zu rasen. Kein schleichender Beginn, kein erkennbarer Auslöser – es ist, als würde ein Schalter umgelegt. Der Puls schnellt in die Höhe, das Herz klopft bis in den Hals, manchmal wird einem schwindelig, manchmal kommt Angst auf. Wer so etwas zum ersten Mal erlebt, denkt unweigerlich an das Schlimmste – Herzinfarkt, Kreislaufzusammenbruch, Lebensgefahr. Doch häufig steckt dahinter eine spezielle Form der Herzrhythmusstörung, die sich AVNRT (atrioventrikuläre nodale Reentry-Tachykardie) nennt. Der Name klingt kompliziert, das Gefühl bedrohlich – und doch ist die Erkrankung in den allermeisten Fällen gutartig und heilbar.
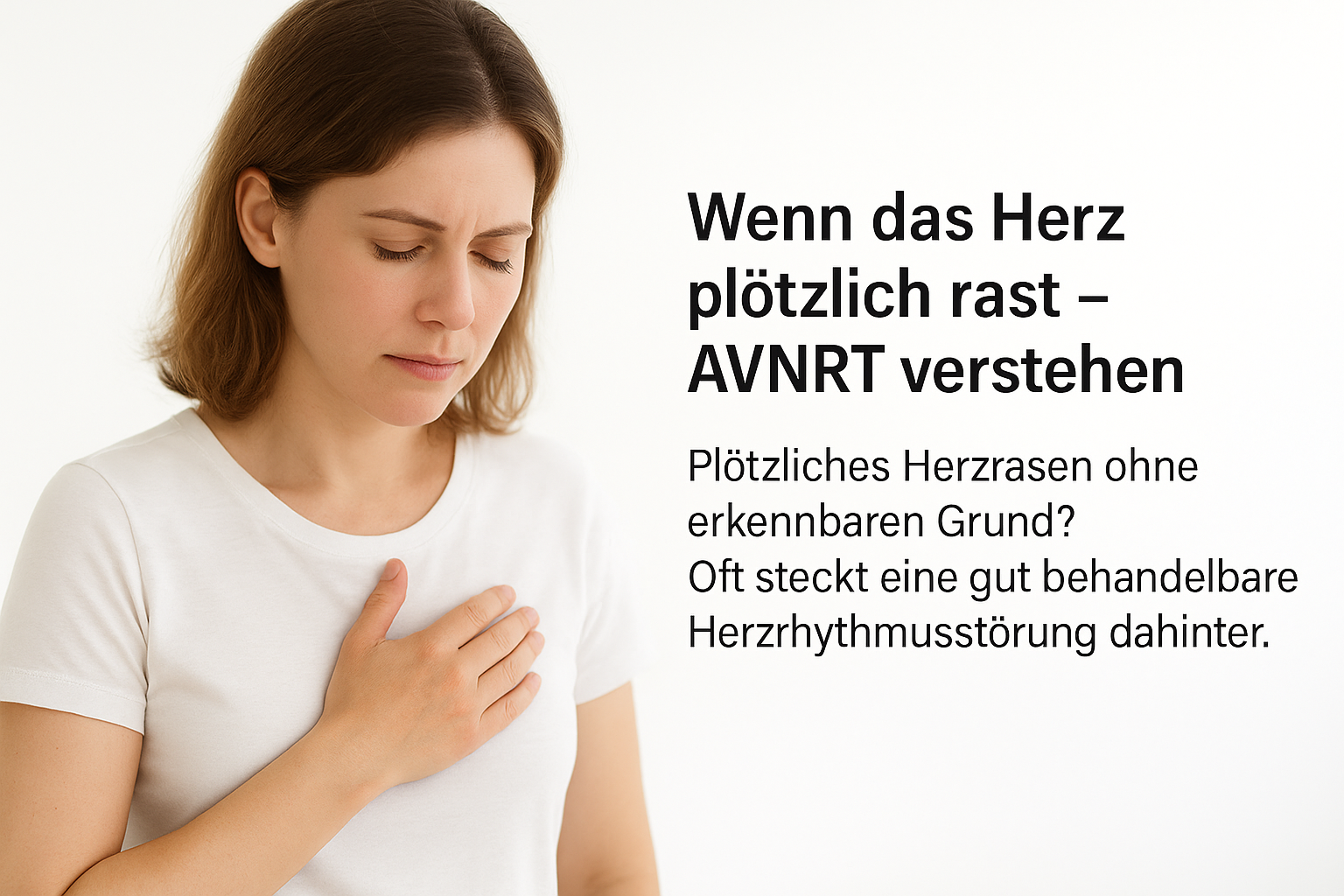
Was bei einer AVNRT im Herzen geschieht
Um zu verstehen, was bei einer AVNRT passiert, hilft ein kurzer Blick auf die feine elektrische Steuerung des Herzens. Jeder Herzschlag entsteht durch einen Impuls aus dem sogenannten Sinusknoten – dem natürlichen Taktgeber des Herzens. Dieser Impuls wandert durch die Vorhöfe, erreicht den Atrioventrikularknoten, kurz AV-Knoten, und wird von dort an die Herzkammern weitergeleitet, damit sie sich zusammenziehen. Der AV-Knoten ist dabei eine Art „Verteilerstation“ zwischen den oberen und unteren Herzhöhlen – ein winziger Bereich, in dem sich der elektrische Strom für den Bruchteil einer Sekunde sammelt, bevor er weitergeleitet wird.
Bei einer AVNRT entsteht nun ein Kreislauf im System: Statt dass der Impuls nur einmal durch den AV-Knoten läuft, findet er dort zwei mögliche Wege – eine langsame und eine schnelle Leitungsbahn. Gerät das System aus dem Gleichgewicht, zum Beispiel durch einen Extraschlag, kann der elektrische Strom in einem kreisenden Muster zwischen diesen Bahnen zirkulieren. Das Ergebnis ist ein sich selbst erhaltender Rhythmus, der das Herz mit rasanter Geschwindigkeit schlagen lässt – oft zwischen 150 und 250 Mal pro Minute. Für den Betroffenen fühlt sich das wie ein Herz „außer Kontrolle“ an, obwohl der Kreislauf dabei meist stabil bleibt.
Wie sich eine AVNRT anfühlt
Die Symptome einer AVNRT sind charakteristisch und für viele Betroffene so eindeutig, dass sie den Anfall später genau beschreiben können. Das Herzrasen beginnt urplötzlich – wie ein Startsignal. Es gibt keinen Übergang, keine langsame Beschleunigung, sondern einen Moment, in dem man merkt: „Jetzt ist es wieder da.“ Der Puls hämmert gleichmäßig, aber viel zu schnell. Manche spüren das Herz bis in den Hals schlagen, andere fühlen einen Druck hinter dem Brustbein, als würde das Herz gegen etwas anstoßen. Hinzu kommt oft ein Gefühl von Hitze, Unruhe oder Schwindel, das nicht selten Angst auslöst.
Besonders tückisch ist, dass diese Attacken ohne erkennbare Ursache auftreten können – im Liegen, beim Bücken, manchmal nach einem Schluck kalten Wassers. Sie können Sekunden dauern, aber auch über Stunden anhalten. Ebenso abrupt, wie sie beginnen, hören sie meist auch wieder auf. Danach fühlen sich viele Menschen müde, innerlich aufgewühlt und verunsichert. Dieses Erlebnis hinterlässt Spuren, nicht körperlich, sondern emotional: das Gefühl, dem eigenen Herzrhythmus nicht mehr trauen zu können.
Warum AVNRT entsteht – ein Kreislauf im Knoten
Die Ursache liegt fast immer in der Struktur des AV-Knotens selbst. Etwa jeder Fünfte trägt von Geburt an die anatomische Anlage für zwei Leitungsbahnen in sich – eine schnellere, die unter normalen Bedingungen aktiv ist, und eine langsamere, die nur in bestimmten Situationen leitend wird. Dieses Doppelbahnsystem ist in den meisten Fällen unproblematisch, kann aber bei bestimmten Impulskonstellationen zu einem „elektrischen Kreisverkehr“ führen. Der entscheidende Moment ist oft ein Extraschlag, der zu früh kommt und die normale Weiterleitung kurzzeitig blockiert. Der Impuls läuft dann über den langsameren Weg und kehrt anschließend über die schnellere Bahn zurück – der Kreislauf beginnt.
Warum genau das bei manchen Menschen häufiger geschieht als bei anderen, ist bis heute nicht vollständig geklärt. Stress, Schlafmangel, Alkohol, Kaffee oder hormonelle Schwankungen können das Risiko erhöhen, ebenso wie bestimmte Medikamente. Doch auch Menschen ohne erkennbare Auslöser erleben solche Attacken. Das zeigt, wie sensibel und fein abgestimmt das elektrische System des Herzens ist – und wie leicht es aus dem Gleichgewicht geraten kann.
Wie die Diagnose gestellt wird
Die Diagnose einer AVNRT ist für Ärzte meist eindeutig, wenn sie während eines Anfalls ein EKG ableiten können. Das Bild zeigt eine regelmäßige, sehr schnelle Herzfrequenz, bei der die typischen Vorhofzacken (die sogenannten P-Wellen) nicht zu erkennen sind, weil sie im Strommuster des AV-Knotens „versteckt“ liegen. Da die Attacken jedoch unvorhersehbar auftreten, gelingt dieser Nachweis oft nur mit einem Langzeit-EKG oder einem sogenannten Event-Recorder, den die Betroffenen mehrere Tage oder Wochen tragen. So können sie den Beginn eines Anfalls selbst markieren, und die Ärzte erhalten eine genaue Aufzeichnung des Rhythmus.
Manchmal werden zusätzliche Untersuchungen durchgeführt, um andere Ursachen auszuschließen – zum Beispiel Schilddrüsenfunktionsstörungen, Elektrolyt-Ungleichgewichte oder strukturelle Herzerkrankungen. Wenn alles andere unauffällig ist, liefert die AVNRT-Erklärung vielen Betroffenen eine große Erleichterung: Das Herz ist gesund, die Ursache liegt in der „Verdrahtung“ – nicht im Muskel selbst.
Was man im Akutfall tun kann
Auch wenn ein Anfall beängstigend wirkt, kann er oft durch einfache körperliche Maßnahmen beendet werden. Ärztlich empfohlen werden Vagus-Manöver, die den Nervus vagus stimulieren – einen wichtigen Nervenstrang, der den Herzrhythmus beeinflusst. Dazu gehören Techniken wie kräftiges Pressen, Luft anhalten oder das Eintauchen des Gesichts in kaltes Wasser. Diese Reize aktivieren Reflexe, die die Herzfrequenz kurzfristig verlangsamen und den elektrischen Kreis im AV-Knoten unterbrechen können.
Wenn das nicht hilft, kann in der Notaufnahme eine kleine Dosis des Medikaments Adenosin oder Verapamil verabreicht werden. Adenosin stoppt die elektrische Aktivität im AV-Knoten für wenige Sekunden – genug, um den Kreislauf zu unterbrechen und das Herz in den normalen Rhythmus zurückzubringen. Für den Patienten fühlt sich das kurz unangenehm an, aber danach folgt meist eine sofortige Erleichterung. Viele beschreiben es, als würde das Herz „neu starten“ und endlich wieder ruhig schlagen.
Langfristige Behandlung – Heilung durch Ablation
Wenn die Anfälle häufig auftreten oder den Alltag stark beeinträchtigen, ist eine Katheterablation die Therapie der Wahl. Dabei wird ein dünner Katheter über die Leiste in das Herz eingeführt. Unter Röntgenkontrolle und mit feinster Mess-Technik wird die fehlerhafte Leitungsbahn im AV-Knoten genau lokalisiert und gezielt verödet. Der Eingriff erfolgt meist unter örtlicher Betäubung und dauert etwa eine Stunde. Die Erfolgsquote ist beeindruckend hoch – über 95 Prozent der Betroffenen bleiben dauerhaft beschwerdefrei.
Nach der Ablation ist in der Regel keine medikamentöse Therapie mehr notwendig. Viele Menschen berichten, dass sie sich zum ersten Mal seit Jahren wieder sicher fühlen – frei von der ständigen Angst, dass das Herz aus dem Takt geraten könnte. Das Vertrauen in den eigenen Körper kehrt zurück, und das Leben gewinnt wieder an Leichtigkeit.
Wenn die Ablation nicht den gewünschten Erfolg bringt
So sicher und erfolgreich die Katheterablation in den meisten Fällen auch ist – es gibt Situationen, in denen der gewünschte Effekt nicht vollständig erreicht wird. Manchmal kehrt das Herzrasen nach einigen Wochen oder Monaten zurück, weil winzige Leitungsreste im AV-Knoten verblieben sind, über die sich der elektrische Kreis erneut bilden kann. In anderen Fällen ist der Eingriff technisch schwierig, etwa weil die anatomischen Verhältnisse im Herzen individuell abweichen oder der Ursprung der Rhythmusstörung schwer zugänglich liegt. Für Betroffene kann das zunächst enttäuschend sein, besonders wenn die Hoffnung groß war, die Attacken endgültig loszuwerden.
Doch ein nicht vollständiger Erfolg bedeutet keineswegs, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Häufig kann eine zweite Ablation den Kreislauf endgültig beseitigen. Bei diesem erneuten Eingriff profitieren die Ärzte von den exakten Messdaten der ersten Behandlung – sie wissen bereits, wo die fehlerhafte Bahn verläuft, und können gezielter und präziser arbeiten. Die Erfolgsrate eines zweiten Eingriffs ist deshalb meist sehr hoch. Viele Menschen, bei denen die erste Ablation nicht ausreichte, berichten nach der Wiederholung über dauerhafte Beschwerdefreiheit.
Für diejenigen, bei denen trotz mehrfacher Behandlungen Anfälle bestehen bleiben, stehen zusätzliche Wege offen. Eine Option ist die medikamentöse Dauertherapie mit Rhythmus-stabilisierenden Medikamenten (Antiarrhythmika) wie Verapamil oder Flecainid. Diese Mittel können das Auftreten von Anfällen deutlich verringern und die Intensität der Symptome mindern. Die Therapie wird individuell abgestimmt und regelmäßig ärztlich kontrolliert, da diese Medikamente gezielt wirken, aber auch sorgfältig überwacht werden müssen.
Manchmal entscheiden sich Ärztinnen und Ärzte gemeinsam mit ihren Patienten auch für eine Kombination aus medikamentöser Behandlung und der Beobachtung, ob sich die Häufigkeit der Anfälle im Laufe der Zeit von selbst verringert. Denn bei manchen Menschen tritt AVNRT in jungen Jahren häufiger auf und verliert später von selbst an Intensität. Auch begleitende Maßnahmen wie Stressreduktion, bewusste Pausen, geregelter Schlaf und ein gesunder Umgang mit Koffein und Alkohol können den Kreislauf positiv beeinflussen.
Wichtig ist vor allem, dass ein Rückfall nach einer Ablation nicht als persönliches Versagen empfunden wird. Die Technik ist hochentwickelt, aber das Herz bleibt ein individuelles Organ mit feinen Eigenheiten. Eine zweite Chance ist oft erfolgreich, und selbst wenn nicht, gibt es verlässliche Wege, um mit der Rhythmusstörung gut zu leben. Das Ziel bleibt immer dasselbe: ein Herz, das ruhig, gleichmäßig und im eigenen Tempo schlägt – und ein Mensch, der sich wieder sicher fühlt.
Wie gefährlich ist AVNRT wirklich?
So bedrohlich die Symptome auch erscheinen – medizinisch ist die AVNRT in den allermeisten Fällen harmlos. Sie führt nicht zu einer Schädigung des Herzmuskels und löst auch keine Herzinfarkte aus. Gefährlich ist vielmehr die Angst, die sie auslöst: das Gefühl, der Kontrolle über den eigenen Körper beraubt zu sein. Diese psychische Belastung kann tief gehen und sollte ernst genommen werden. Gespräche mit Ärztinnen und Ärzten, Aufklärung über den Mechanismus und gegebenenfalls psychologische Unterstützung können helfen, diese Angst wieder zu lösen. Denn zu wissen, was im Körper geschieht, nimmt dem Geschehen seine Bedrohlichkeit.
Ein Herz, das wieder Vertrauen schenkt
Wer eine AVNRT erlebt hat, kennt das Gefühl der Hilflosigkeit. Doch gleichzeitig zeigt diese Erfahrung, wie fein abgestimmt und sensibel das menschliche Herz ist – ein Organ, das auf kleinste Veränderungen reagiert und doch in seiner Struktur erstaunlich robust bleibt. Nach erfolgreicher Behandlung kehrt meist nicht nur der normale Rhythmus zurück, sondern auch ein Stück innere Ruhe. Es ist der Moment, in dem man das eigene Herz wieder als Verbündeten spürt – nicht als Gegner.
AVNRT mag spektakulär beginnen, aber sie kann ebenso spektakulär enden – mit einer Heilung, die das Vertrauen in den eigenen Körper wiederherstellt. Und vielleicht ist genau das die wichtigste Botschaft: Ein Herz, das im richtigen Takt schlägt, ist mehr als nur ein Zeichen von Gesundheit – es ist ein Symbol für Sicherheit, Ruhe und neues Lebensgefühl.






