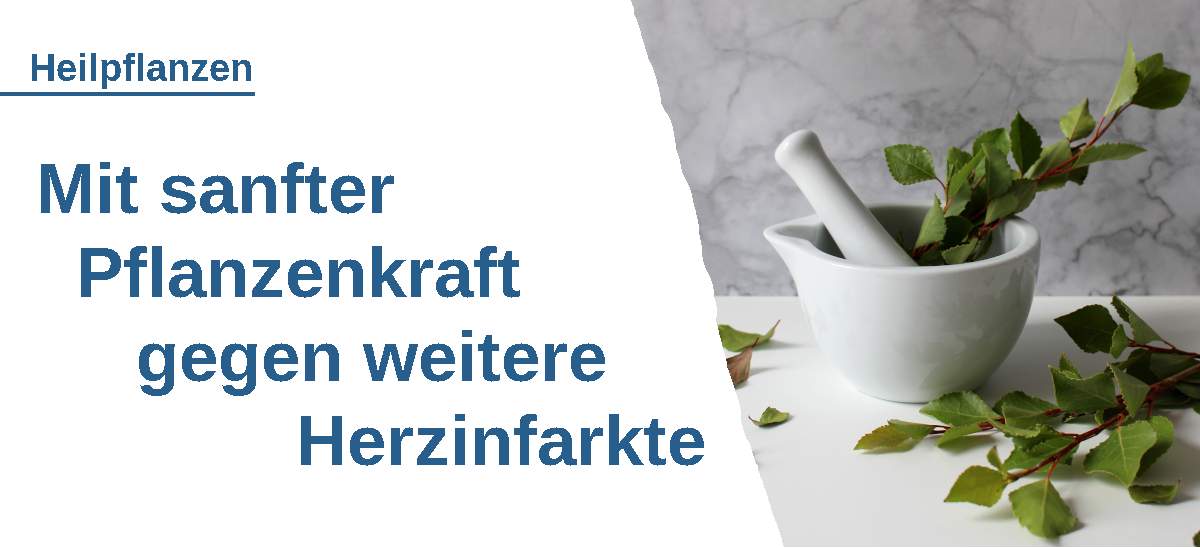Autor: Mazin Shanyoor
Ein Herzinfarkt verändert dein Leben von einem Moment auf den anderen. Plötzlich steht die eigene Gesundheit, die bislang selbstverständlich schien, im Mittelpunkt aller Gedanken. Besonders heimtückisch ist der Hinterwandinfarkt. Während viele bei „Herzinfarkt“ an massive Schmerzen in der Brust denken, zeigt sich der Hinterwandinfarkt oft leiser, unscheinbarer – und gerade deshalb gefährlich. Seine Signale werden leicht als Magenproblem, Völlegefühl oder Verdauungsstörung fehlgedeutet. Hinter scheinbar banalen Beschwerden kann sich ein lebensbedrohlicher Notfall verbergen.

Wie der Hinterwandinfarkt entsteht
Das Herz ist ein kräftiger Muskel, der unermüdlich Blut durch deinen Körper pumpt und dafür selbst eine konstante Sauerstoff- und Nährstoffversorgung benötigt. Diese erhält es über die Herzkranzgefäße. Beim Hinterwandinfarkt ist meist die rechte Koronararterie entscheidend: Sie versorgt die hintere Wand der linken Herzkammer. Wird dieses Gefäß plötzlich verengt oder verschlossen – häufig durch ein Blutgerinnsel auf einer vorgeschädigten, verkalkten Gefäßwand – entsteht in diesem Areal akuter Sauerstoffmangel. Innerhalb von Minuten beginnen Herzmuskelzellen abzusterben. Dieser Verlust ist unumkehrbar. Entscheidend ist, wie schnell du behandelt wirst: Je früher der Blutfluss zurückkehrt, desto kleiner bleibt der Schaden und desto besser bleibt die Pumpkraft des Herzens erhalten.
Symptome, die trügen können – warum der Hinterwandinfarkt so schwer zu erkennen ist
Beim Hinterwandinfarkt fehlen oft die „klassischen“ Zeichen. Statt einer einschnürenden Brustenge erlebst du möglicherweise ein diffuses Unwohlsein. Häufig steht ein Schmerz oder Brennen im Oberbauch im Vordergrund, der wie Sodbrennen oder eine Magenschleimhautentzündung wirkt. Weil sich das Gefühl nach Mahlzeiten verstärken kann, wird es leicht als Verdauungsbeschwerde gedeutet. Anhaltende Übelkeit, teils mit Erbrechen, ist gerade bei älteren Menschen und bei Frauen häufig – ein Grund, warum der Infarkt als Magen-Darm-Problem missverstanden wird.
Ebenso typisch, aber irreführend, ist ein nicht erklärbares Völlegefühl oder ein Druck „aus dem Bauch heraus“ zusammen mit einer leichten Brustschwere. Viele Betroffene bemerken Schmerzen, die in den Rücken ausstrahlen – zum Beispiel ein Ziehen zwischen den Schulterblättern oder dumpfe, als Rückenschmerz empfundene Beschwerden. Auch Kiefer-, Nacken- oder Armschmerz, einseitig oder beidseitig, kommt vor; manche spüren lediglich Kribbeln oder Taubheitsgefühle bis in Schulter oder Oberarm.
Vegetative Reaktionen sind häufig: plötzlicher kalter Schweiß ohne Anstrengung, Blässe, Herzrasen oder Herzstolpern, Schwindel bis hin zur drohenden Ohnmacht. Besonders tückisch sind stumme oder nahezu schmerzlose Infarkte, die etwa bei Diabetes durch eine verringerte Schmerzempfindung begünstigt werden. Hier zeigen sich oft nur allgemeine Schwäche, Luftnot oder ein unbestimmtes Krankheitsgefühl.
Nicht zuletzt spielt die Psyche mit: Viele beschreiben eine plötzlich aufsteigende Angst oder das deutliche Gefühl, „etwas stimmt ganz und gar nicht“, ohne es benennen zu können. Die Summe dieser leisen, unspezifischen Zeichen macht den Hinterwandinfarkt gefährlich. Wer unerklärliche Oberbauchbeschwerden, anhaltende Übelkeit oder ungewöhnliche Rücken- oder Kieferschmerzen hat – besonders zusammen mit Schweißausbruch, Schwindel oder Atemnot – sollte umgehend medizinische Hilfe anfordern. Zeit bedeutet Herzmuskel – und damit Leben.
Die Herausforderung der Diagnose
In der Notaufnahme ist das Elektrokardiogramm (EKG) der erste Baustein der Abklärung. Beim Hinterwandinfarkt fehlen jedoch nicht selten die markanten Muster, die vordere Infarkte verraten. Deshalb ergänzen Ärztinnen und Ärzte das Standard-EKG um zusätzliche Ableitungen, die den hinteren Wandbereich besser erfassen. Ein Herzultraschall kann eine gestörte Wandbewegung sichtbar machen. Parallel liefern Blutwerte – insbesondere Troponin – den biochemischen Beleg für geschädigte Herzmuskelzellen. Weil Troponin erst nach kurzer Zeit zuverlässig ansteigt, zählt jede Minute bis zur gesicherten Diagnose. Technik hilft, Erfahrung entscheidet: Wer die leisen Signale ernst nimmt und früh an einen Hinterwandinfarkt denkt, verkürzt den Weg zur rettenden Therapie.
Die Behandlung – schnelle Rettung für das Herz
Ein Hinterwandinfarkt ist ein dramatischer Notfall. Der Leitsatz lautet: Zeit ist Herzmuskel. Bereits vor Klinikankunft beginnt die Akuttherapie. Bei Infarktverdacht sollte sofort der Notruf erfolgen. Der Rettungsdienst stabilisiert Atmung und Kreislauf, verabreicht bei niedriger Sauerstoffsättigung Sauerstoff, lindert Schmerzen und gibt früh Medikamente zur Blutverdünnung. Üblich sind Acetylsalicylsäure, um das Gerinnsel an der Gefäßwand anzugreifen, und Heparin zur Hemmung der Gerinnung insgesamt. Beruhigende und übelkeitshemmende Mittel reduzieren Stress und vegetative Beschwerden, die Herzfrequenz und Sauerstoffverbrauch erhöhen könnten.
In der Klinik steht das Herzkatheterlabor im Zentrum der Akutbehandlung. Über eine Arterie am Handgelenk oder in der Leiste wird ein Katheter bis zur verschlossenen Stelle geführt. Unter Röntgenkontrolle weitet ein kleiner Ballon die Engstelle auf, sodass das Blut wieder fließt. Anschließend stabilisiert ein Stent – ein feines Metallgitter – das Gefäß dauerhaft. Diese perkutane Koronarintervention ist heute Standard und verbessert Überleben und Herzfunktion deutlich.
Wenn ein Katheterzentrum nicht rechtzeitig erreichbar ist, kann als Brücke eine Lysetherapie erfolgen: Medikamente lösen das Gerinnsel medikamentös an. Sie wirkt weniger gezielt und erhöht das Blutungsrisiko, kann jedoch lebensrettend sein, bis die Katheterbehandlung möglich wird. Ziel bleibt stets die schnellstmögliche mechanische Wiedereröffnung in einem spezialisierten Zentrum.
Nach der Akutintervention sichern begleitende Medikamente das Ergebnis. Dauerhaft kommt Acetylsalicylsäure zum Einsatz, meist kombiniert mit einem zweiten Plättchenhemmer wie Clopidogrel, Prasugrel oder Ticagrelor (dual antithrombozytäre Therapie), um Stentthrombosen zu verhindern. Betablocker drosseln Herzfrequenz und Sauerstoffbedarf, ACE-Hemmer oder AT1-Blocker unterstützen die Remodeling-Kontrolle und stabilisieren die Pumpfunktion, Statine senken LDL-Cholesterin und vermindern das Risiko weiterer Gefäßereignisse. Bei Bedarf ergänzen Nitrate, Morphin und Antiemetika die Symptomkontrolle.
Beim Hinterwandinfarkt sind Rhythmusstörungen besonders im Blick. AV-Blockierungen können den Herzschlag gefährlich verlangsamen; bei Bedarf wird vorübergehend ein Schrittmacher gelegt. Kammerflimmern oder andere gefährliche Arrhythmien erfordern sofortige Defibrillation. Darum erfolgt die Überwachung auf einer Intensiv- oder Überwachungsstation, wo lückenloses Monitoring und rasches Eingreifen gewährleistet sind.
Die Therapie endet nicht mit der Akutphase. Stabilisiert sich der Zustand, beginnt die Nachsorge. In einer mehrwöchigen Herz-Reha steigerst du deine Belastbarkeit unter ärztlicher Anleitung, lernst Risikofaktoren konsequent anzugehen – Rauchstopp, Blutdruck- und Blutzuckerkontrolle, Bewegung, Ernährung – und erhältst psychologische Unterstützung. Die konsequente Einnahme der verordneten Medikamente, regelmäßige ärztliche Kontrollen und das Verständnis der eigenen Warnsignale senken das Rückfallrisiko und stärken Vertrauen in den eigenen Körper.
Prognose – Leben nach dem Infarkt
Die Aussichten hängen vor allem von der Zeit bis zur Gefäßöffnung, von der Größe des betroffenen Areals und von Begleiterkrankungen ab. Früh behandelt bleiben oft große Teile des Herzmuskels erhalten, und viele kehren mit guter Lebensqualität in den Alltag zurück. Möglich sind dennoch Folgen wie Herzschwäche oder wiederkehrende Rhythmusstörungen, die im Einzelfall weitere Maßnahmen bis hin zum Schrittmacher erfordern können. Mit Reha, konsequenter Medikation und einem lebenspraktischen Präventionsplan lässt sich die Perspektive deutlich verbessern.
Die seelische Dimension
Ein Herzinfarkt trifft nicht nur den Körper. Ängste, Grübeln und der Verlust des Vertrauens in die eigene Belastbarkeit sind häufig. Schon kleine Signale – ein Stolpern, ein Druckgefühl – können beunruhigen. Sprich darüber, nimm psychologische Begleitung an und nutze Reha-Gruppen oder Selbsthilfeangebote. Verständnis im persönlichen Umfeld hilft dir, Sicherheit zurückzugewinnen. Ein Infarkt ist nicht das Ende, sondern kann der Beginn eines bewussteren, stabileren Lebensabschnitts sein.
Fazit – auf die leisen Signale hören
Der Hinterwandinfarkt ist ein leiser, aber gefährlicher Gegner. Unerklärliche Oberbauchbeschwerden, Übelkeit, Schweißausbrüche, Rücken- oder Kieferschmerz und Schwindel verdienen höchste Aufmerksamkeit – besonders, wenn mehrere Zeichen zusammenkommen. Zögere nicht, den Notruf zu wählen. Moderne Akuttherapie, sorgfältige Nachsorge und ein realistischer Präventionsplan geben dir heute sehr gute Chancen auf ein gutes, sicheres Leben nach dem Infarkt.
Quellen, Leitinien & Studien
Herzinfarkt
- Medical Xpress. (2021, Juni 7). Long-term survival after a heart attack or acute myocardial infarction in Australia and New Zealand. Abgerufen am 09..02.2024, von medicalxpress.com
- Epic Heart and Vascular Center. (2023, März 15). What is Average Life Expectancy After Heart Attack By Age? Epic Heart and Vascular. Abgerufen am 09..02.2024, von epicheartandvascular.com
- CardioSound. (n.d.). Heart attack survivor statistics. Abgerufen am 09..02.2024, von https://cardiosound.com
Verwandte Beiträge
Meist gelesen
Warum kommt es oft nach einem Herzinfarkt zu Depressionen?
Autor: Mazin Shanyoor
Nach einem Herzinfarkt erleben viele Patienten eine tiefe emotionale und psychologische Belastung, die oft in Depressionen münden kann. Diese psychische Reaktion ist vielschichtig und wird durch eine Kombination von physiologischen, emotionalen und sozialen Faktoren ausgelöst. Die Erfahrung eines Herzinfarkts kann traumatisch sein und viele Betroffene werden plötzlich mit ihrer eigenen Sterblichkeit konfrontiert. Diese existenziellen Ängste können überwältigend sein und ein Gefühl der Verletzlichkeit und Unsicherheit hervorrufen. Die Unsicherheit über die eigene Gesundheit und die Zukunft kann ständige Sorgen auslösen, die schwer zu bewältigen sind.