Autor: Mazin Shanyoor
Eine Brustkrebsdiagnose trifft Frauen oft mitten im Leben. Familie, Beruf, Partnerschaft – all das wird von einem Moment auf den anderen von einer neuen, alles bestimmenden Realität überlagert. Neben der körperlichen Herausforderung, die die Erkrankung mit sich bringt, bedeutet Brustkrebs für viele auch einen tiefen Einschnitt in das Selbstbild, die Weiblichkeit und das Vertrauen in den eigenen Körper.
Die erste Erschütterung – Stress nach der Diagnose
Der Moment, in dem die Worte „Sie haben Brustkrebs“ ausgesprochen werden, verändert für viele Frauen alles. Oft reichen wenige Sekunden, um das bisherige Leben in ein „Davor“ und ein „Danach“ zu teilen. In dieser Situation läuft im Inneren ein Sturm ab: Der Herzschlag beschleunigt sich, der Atem stockt, die Gedanken überschlagen sich. Viele Betroffene berichten, dass sie den Rest des Gesprächs kaum noch bewusst wahrgenommen haben – als ob ein unsichtbarer Vorhang gefallen wäre.
Häufig mischen sich Schock, Angst, Unglauben und eine tiefe Verunsicherung. Plötzlich stellen sich Fragen, die zuvor unvorstellbar waren: Werde ich das überleben? Was passiert mit meiner Familie? Werde ich jemals wieder gesund? Dieser Moment trifft nicht nur den Verstand, sondern erschüttert das gesamte Selbstgefühl.
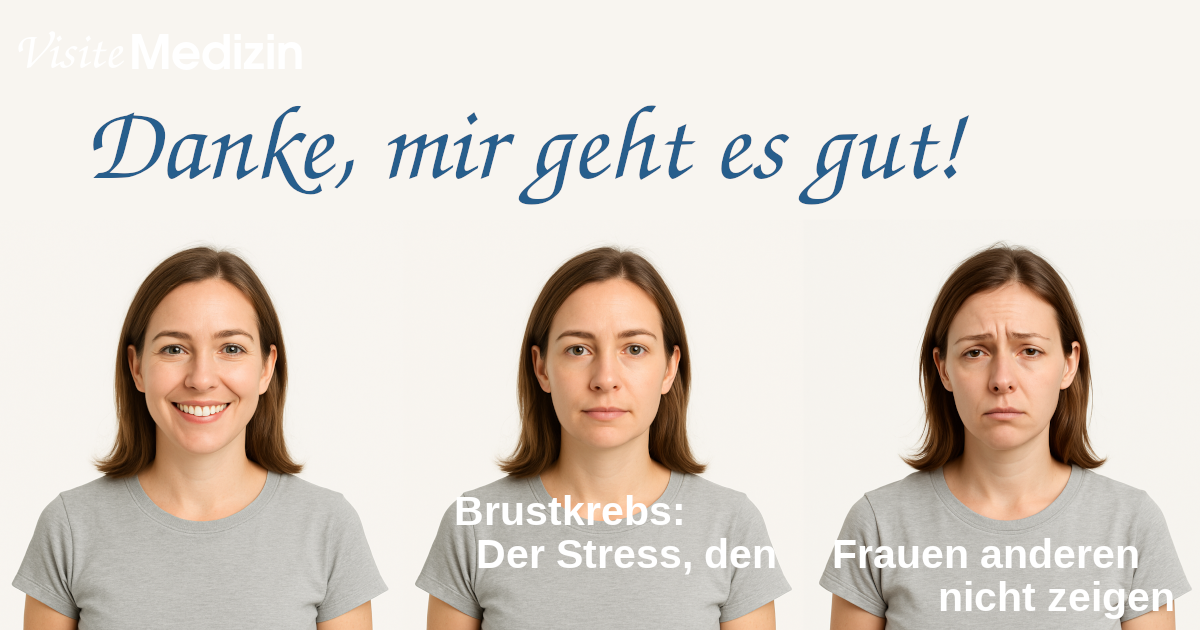
Der Körper reagiert darauf mit einer sofortigen Alarmreaktion. Stresshormone wie Adrenalin und Cortisol werden ausgeschüttet, um auf „Gefahr“ zu reagieren – eine uralte Überlebensfunktion, die ursprünglich dazu diente, in Sekundenbruchteilen handlungsfähig zu sein. Im Kontext einer Krebsdiagnose bedeutet das jedoch nicht, dass „gehandelt“ werden kann. Stattdessen bleibt der Körper in einem Zustand höchster Anspannung, ohne dass es eine schnelle Lösung gibt.
Diese erste Phase ist für viele auch von einem Gefühl der Entfremdung geprägt. Der Alltag läuft weiter – Gespräche, Termine, vielleicht sogar Arbeit –, doch innerlich steht alles still. Manche beschreiben es so, als würden sie durch eine Glasscheibe auf ihr eigenes Leben schauen. Selbst nahestehende Menschen finden oft keine Worte, um diesen Schock zu fassen.
In dieser Anfangszeit kann es schwerfallen, Informationen zu verarbeiten oder Entscheidungen zu treffen. Das medizinische Umfeld bemüht sich zwar, wichtige Fakten zu vermitteln, doch nicht selten bleiben diese in der Erinnerung verschwommen zurück. Die seelische Wucht dieses Moments ist so groß, dass sie sich tief einprägt – und für viele Frauen den Beginn einer längeren, oft sehr kräftezehrenden Stressphase markiert.
Die Belastung während der Behandlung
Nach dem ersten Schock beginnt für viele Frauen eine Phase, die körperlich wie seelisch alles abverlangt: die Behandlung. Operation, Chemotherapie, Bestrahlung oder Antihormontherapie sind medizinisch notwendig, um den Krebs zu bekämpfen – doch sie bedeuten auch, den Körper immer wieder an seine Grenzen zu bringen.
Schon die ersten Schritte, wie die Vorbereitung auf eine Operation, können belastend sein. Das Wissen, dass ein Teil des eigenen Körpers entfernt wird – oft verbunden mit der Brust als Symbol für Weiblichkeit, Intimität und Identität – ist für viele Frauen ein tiefer Einschnitt, der weit über das Medizinische hinausgeht. Selbst wenn die Entscheidung für den Eingriff klar ist, löst er oft Gefühle von Verlust, Trauer und Unsicherheit über das eigene Körperbild aus.
Chemotherapie und Bestrahlung bringen ihre ganz eigenen Herausforderungen mit sich. Übelkeit, Haarausfall, Hautveränderungen, Geschmacksverlust oder extreme Müdigkeit sind sichtbare und spürbare Folgen, die nicht nur das körperliche Wohlbefinden, sondern auch das Selbstwertgefühl beeinflussen. Hinzu kommt, dass die Therapiezeit den Alltag oft völlig umkrempelt: Termine, Behandlungspläne und Wartezeiten in Kliniken bestimmen den Rhythmus, während das bisherige Leben in den Hintergrund tritt.
Nicht zu unterschätzen sind die emotionalen Momente zwischen den Behandlungen. Viele Frauen erleben Phasen intensiver Angst, etwa vor den nächsten Untersuchungsergebnissen oder vor Nebenwirkungen, die sich verstärken könnten. Auch kleine körperliche Veränderungen werden in dieser Zeit oft mit großer Wachsamkeit wahrgenommen – manchmal begleitet von der Sorge, ob sie Anzeichen einer Verschlechterung sein könnten.
Das Umfeld reagiert unterschiedlich: Manche Angehörige sind eine große Stütze, andere sind überfordert oder ziehen sich zurück, weil sie nicht wissen, wie sie helfen sollen. Für Betroffene kann das Gefühl entstehen, gleichzeitig „kämpfen“ und „funktionieren“ zu müssen – nach außen stark zu wirken, während innerlich die Kräfte schwinden.
Diese dauerhafte körperliche und seelische Anspannung hält das Stresssystem oft über Monate hinweg im Alarmmodus. Selbst wenn zwischen den Therapien kurze Ruhepausen möglich sind, gelingt es vielen nicht, innerlich wirklich loszulassen. Die Behandlung wird so zu einer doppelten Belastung: einer medizinischen Herausforderung und einer dauerhaften psychischen Ausnahmesituation.
Die sensible Phase der Remission
Wenn die akute Therapie abgeschlossen ist und die Untersuchungen zunächst keine Anzeichen mehr für aktiven Krebs zeigen, beginnt eine Phase, die für viele von außen wie das ersehnte Ziel wirkt: die Remission. Doch während Angehörige und Freunde oft erwarten, dass jetzt „alles wieder gut“ ist, erleben viele Frauen diese Zeit als eine neue, unerwartet schwierige Herausforderung.
Zunächst ist da die körperliche Erschöpfung, die oft noch lange nachwirkt. Die Nebenwirkungen der Behandlungen – ob Narben, Lymphödeme, hormonelle Veränderungen oder eine anhaltende Fatigue – verschwinden nicht mit dem letzten Arzttermin. Für viele bleibt der Körper ein täglicher Hinweis darauf, was geschehen ist. Selbst kleine Veränderungen können Ängste wecken, besonders wenn die Erinnerung an die Diagnose noch frisch ist.
Emotional ist die Remission häufig ein Wechselspiel zwischen Dankbarkeit und Sorge. Einerseits ist die Freude groß, dass die akute Bedrohung vorerst gebannt ist. Andererseits fehlt plötzlich die engmaschige medizinische Betreuung, die während der Behandlung Sicherheit gegeben hat. Die regelmäßigen Kontrolltermine, die für Ärzte ein normaler Ablauf sind, werden für Betroffene zu emotional aufgeladenen Momenten – jeder Termin kann die Angst vor einem Rückfall neu entfachen.
Diese Zeit ist auch eine Phase des Umbruchs im Alltag. Manche kehren in den Beruf zurück, andere müssen sich neu orientieren. Gleichzeitig gilt es, Rollen in der Familie wiederzufinden, die sich während der Krankheit verändert haben. Für viele entsteht hier eine stille Unsicherheit: Wie sehr darf man sich wieder belasten? Was ist „normal“? Und wie geht man mit der ständigen Sorge im Hintergrund um?
Nicht selten tauchen in der Remission auch Gefühle auf, die während der Behandlung keinen Raum hatten: Traurigkeit über den Verlust einer Brust, über körperliche Veränderungen oder über die Zeit, die unwiderruflich von der Krankheit geprägt war. Auch zwischenmenschlich kann diese Phase sensibel sein – manche Beziehungen werden enger, andere geraten unter Spannung, weil die unausgesprochenen Ängste schwer zu teilen sind.
Die Remission ist daher weniger ein klarer Endpunkt, sondern vielmehr ein Übergang: ein Weg, auf dem Körper und Seele lernen müssen, wieder Vertrauen zu fassen – in das Leben, in die Gesundheit und in die eigene Zukunft. Das braucht Zeit, Geduld und oft auch professionelle Unterstützung.
Der ständige Alarmzustand – warum er so ungesund ist
Für viele Frauen endet der innere Ausnahmezustand nicht mit der letzten Behandlung. Auch wenn der Krebs medizinisch zurückgedrängt oder besiegt ist, bleibt das Stresssystem oft in höchster Bereitschaft – als würde der Körper ständig auf einen nächsten Angriff warten. Dieser sogenannte „Dauer- oder Alarmzustand“ ist keine bewusste Entscheidung, sondern eine tief verwurzelte Reaktion des Nervensystems, das auf die lange Zeit der Bedrohung und Unsicherheit geprägt wurde.
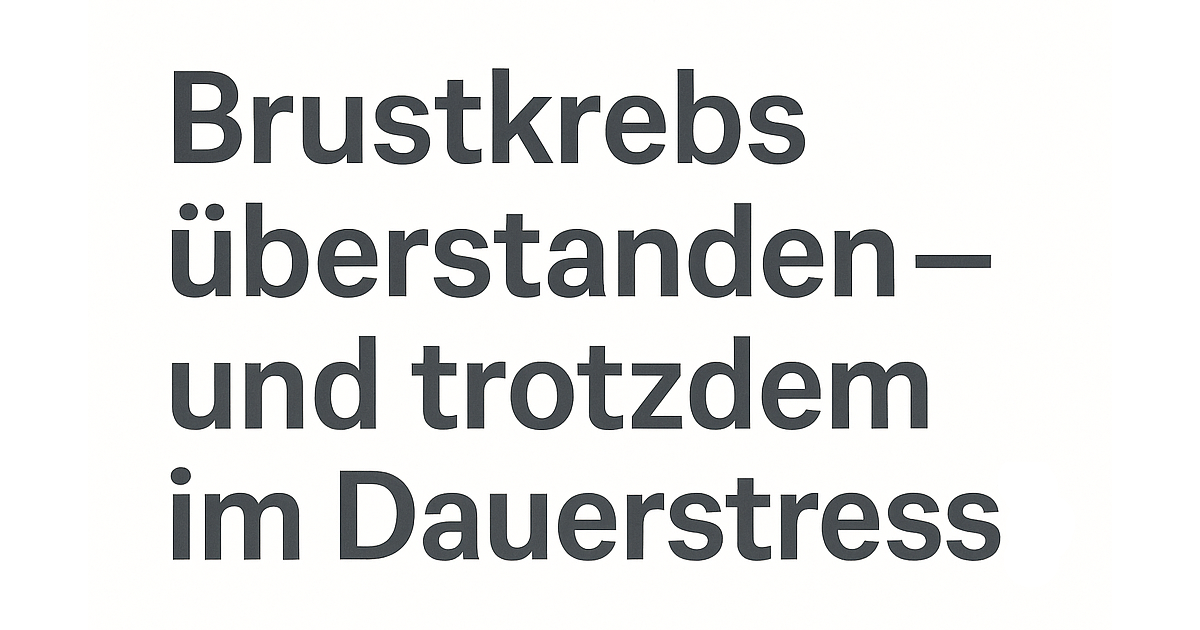
In diesem Zustand reagiert der Körper auch in eigentlich sicheren Momenten, als stünde Gefahr bevor: Das Herz schlägt schneller, die Muskeln sind angespannt, die Atmung ist flacher. Selbst kleine Auslöser – ein Arzttermin, ein bestimmter Geruch aus der Klinik, ein Bericht über Krebs im Fernsehen – können die innere Alarmanlage sofort aktivieren. Viele Betroffene beschreiben, dass sie „nicht mehr richtig herunterfahren“ können, selbst wenn sie Ruhe suchen.
Doch dieser Dauerstress hat seinen Preis. Wenn Stresshormone wie Cortisol und Adrenalin über lange Zeit erhöht bleiben, wirkt sich das auf nahezu alle Körpersysteme aus:
- Immunsystem: Die Abwehrkräfte werden geschwächt, Entzündungsprozesse im Körper können leichter entstehen.
- Herz-Kreislauf-System: Erhöhter Blutdruck, Herzrasen und ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind mögliche Folgen.
- Hormonsystem: Das Gleichgewicht von Stress- und Geschlechtshormonen gerät durcheinander, was Wechseljahresbeschwerden verstärken oder die Erholung verzögern kann.
- Nervensystem: Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme und erhöhte Reizbarkeit nehmen zu.
Auch die Psyche leidet. Ein ständiger Alarmzustand fördert Gefühle von Unruhe, Angst und Überforderung. Für manche entsteht eine Art „Dauerschreckhaftigkeit“, bei der jeder unerwartete Reiz als potenzielle Gefahr empfunden wird. Dieses innere „auf Abruf sein“ kostet enorm viel Energie – Energie, die für Heilung, Regeneration und Lebensfreude gebraucht wird.
Die Herausforderung besteht darin, zu erkennen, dass dieser Alarmzustand nicht mehr schützt, sondern belastet. Ihn zu unterbrechen, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu langfristiger Gesundheit. Dazu braucht es bewusst eingeplante Erholungsphasen, gezielte Stressbewältigungsstrategien und oft auch die Erlaubnis, sich selbst wieder Momente der Entspannung und Unbeschwertheit zuzugestehen.
Mögliche Stressreaktionen im Überblick
- Schlafstörungen – Das Einschlafen fällt schwer, weil die Gedanken unaufhörlich kreisen, oder man wacht mitten in der Nacht auf, begleitet von Unruhe oder Albträumen.
- Fatigue (anhaltende Erschöpfung) – Eine tiefe Müdigkeit, die sich nicht durch Schlaf beheben lässt.
- Innere Unruhe – Ein ständiges Gefühl, unter Strom zu stehen.
- Angstzustände – Mal diffus, mal konkret: vor einem Rückfall oder Kontrolluntersuchungen.
- Panikattacken – Plötzliche, überwältigende Angst mit Herzrasen, Atemnot, Schwindel oder Kontrollverlust.
- Posttraumatische Belastungsreaktionen – Ausgelöst durch Erinnerungen an belastende Momente der Behandlung.
Warnsignale für einen anhaltenden Alarmzustand
- Häufige Schlafstörungen ohne erkennbaren äußeren Grund
- Permanente innere Anspannung oder Nervosität
- Wiederkehrende Albträume oder Flashbacks
- Übermäßige Schreckhaftigkeit oder Wachsamkeit
- Anhaltende Erschöpfung trotz Ruhezeiten
- Konzentrations- oder Gedächtnisprobleme
- Gefühl, keine Freude mehr empfinden zu können
Wer mehrere dieser Anzeichen über Wochen hinweg bemerkt, sollte psychologische oder psychoonkologische Unterstützung in Anspruch nehmen.
Die unsichtbare Hürde – warum es so schwer ist, sich mitzuteilen
Für viele betroffene Frauen ist das Schweigen nach einer Brustkrebserkrankung nicht nur eine bewusste Entscheidung, sondern oft auch eine Schutzreaktion – für sich selbst und für die Menschen, die ihnen am nächsten stehen. Die Krankheit hat nicht nur den eigenen Körper verändert, sondern auch das familiäre Gleichgewicht. Viele Frauen spüren, dass ihre Angehörigen selbst unter der Diagnose gelitten haben: der Partner, der plötzlich Angst um die gemeinsame Zukunft hatte, die Kinder, die spürten, dass „etwas nicht stimmt“, oder die Eltern, die ihre erwachsene Tochter in einer existenziellen Krise sehen mussten.
Aus dieser Wahrnehmung heraus entsteht häufig der innere Drang, die anderen zu entlasten. Gespräche über Angst, Müdigkeit oder innere Unruhe werden vermieden – nicht, weil diese Gefühle nicht da sind, sondern weil man glaubt, dass ihre Äußerung das seelische Gleichgewicht der Familie ins Wanken bringen könnte.
Gerade in Partnerschaften vermischt sich dieser Schutzgedanke oft mit einem sehr persönlichen Wunsch: attraktiv, begehrenswert und selbstsicher zu wirken. Veränderungen am Körper – Narben, Hautverfärbungen oder der Verlust einer Brust – werden nicht nur aus Scham, sondern auch aus Angst vor Zurückweisung verborgen. Viele Frauen versuchen, intimen Momenten mit dem Partner eine Leichtigkeit zu geben, die sie innerlich nicht empfinden, um den Eindruck zu erwecken, „alles sei wieder wie früher“.
Auch gegenüber Kindern, egal welchen Alters, ist Zurückhaltung oft die Regel. Kleinere Kinder sollen nicht mit zu vielen Sorgen belastet werden, und erwachsene Kinder werden geschont, um ihnen das Gefühl von Sicherheit zu lassen. Gespräche über Rückfallangst, über Tage, an denen die Erschöpfung überwältigend ist, oder über körperliche Schmerzen, die nach der Therapie bleiben, werden daher häufig auf später verschoben – oder gar nicht geführt.
Im Alltag zeigt sich dieses Schweigen in vielen kleinen Situationen:
- Arzttermine werden heruntergespielt: „Das ist nur eine Routinekontrolle“, obwohl innerlich die Nervosität groß ist.
- Narben und Veränderungen am Körper werden konsequent verborgen – nicht nur vor Fremden, sondern auch vor dem eigenen Partner.
- Innere Unruhe oder Schlaflosigkeit werden mit banalen Erklärungen abgetan, um Nachfragen zu vermeiden.
- Panik oder Angst vor Rückfällen werden stumm ertragen, damit das Familienleben ungestört weiterlaufen kann.
Kurzfristig kann diese Strategie tatsächlich Stabilität vermitteln. Die Familie erlebt eine Frau, die „alles im Griff hat“, und das gibt Sicherheit. Langfristig jedoch entsteht eine doppelte Belastung: Die betroffene Frau trägt nicht nur ihre eigene Angst und Erschöpfung, sondern auch die ständige Anstrengung, diese Gefühle zu verbergen. Dieses permanente Zurückhalten von Emotionen kann zu tiefer Einsamkeit führen – selbst inmitten der engsten Angehörigen.
Dabei zeigen Erfahrungen vieler Betroffener, dass Offenheit oft mehr Verständnis hervorruft, als befürchtet. Partner fühlen sich eher einbezogen als belastet, wenn sie wissen, was die Frau bewegt. Kinder entwickeln häufig eine größere emotionale Reife, wenn sie die Wahrheit in angemessener Form erfahren. Eltern, Geschwister oder enge Freunde können gezielter unterstützen, wenn sie wissen, wo die größten Sorgen liegen.
Sich mitzuteilen, bedeutet nicht, die Kontrolle zu verlieren. Es bedeutet, die Last auf mehrere Schultern zu verteilen – und so Raum für Entlastung, Nähe und gegenseitige Stärke zu schaffen. Oft ist es genau dieser Schritt, der den Weg aus der inneren Isolation ebnet und das Vertrauen in das gemeinsame Leben nach der Krankheit wieder wachsen lässt.
Den Weg aus dem Dauerstress finden – ein Schritt, der Mut braucht
Es braucht Mut, die eigenen Gefühle ernst zu nehmen und Hilfe zuzulassen. Der ständige Alarmzustand ist keine Schwäche, sondern eine nachvollziehbare Folge einer extremen Belastung. Jeder kleine Moment der Ruhe ist ein wichtiger Baustein für Heilung – körperlich wie seelisch.
Mit Geduld, Selbstmitgefühl und Unterstützung lässt sich der Weg in ein Leben mit neuer Stabilität gehen. Und irgendwann steht nicht mehr die Krankheit im Mittelpunkt – sondern das, was das Leben an Freude und Hoffnung bereithält.
Quellen, Leitinien & Studien
- AGO Empfehlungen „Diagnosis and Treatment of Patients with Primary and Metastatic Breast Cancer”, Stand: April 2022: ago-online.de
- Patientenratgeber zu den Empfehlungen der AGO Kommission Mamma, Stand: 2022: ago-online.de
- Interdisziplinäre S3-Leitlinie für die Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Mammakarzinoms, Langversion 4.4, Stand: Juni 2021: leitlinienprogramm-onkologie.de (Abrufdatum am 20.08.2023)
- Deutsche Krebsgesellschaft, Onko Internetportal, Brustkrebs: Basis-Infos für Patientinnen und Angehörige. Online unter krebsgesellschaft.de (Abrufdatum am 20.08.2023).
HER2-positiv
- Joseph A. Sparano et al.: Adjuvant Chemotherapy Guided by a 21-Gene Expression Assay in Breast Cancer, New England Journal of Medicine, June 3, 2018, DOI: 10.1056/NEJMoa1804710
- Schrodi S et al. Outcome of breast cancer patients with low hormone receptor positivity: Analysis of a 15-year population-based cohort. Annals of Oncology, Onlinevorabveröffentlichung am 20.August 2021, https://doi.org/10.1016/j.annonc.2021.08.1988
Aromatasehemmer
- Aktories, K. et al.: Allgemeine und spezielle Pharmakologie und Toxikologie, 11. Auflage, Urban & Fischer Verlag/Elsevier GmbH, 2013.
- Fachinformation: Exemestan, unter: www.fachinfo.de, (Abruf: 23.08.2023).
- Geisslinger, G. et al.: Mutschler Arzneimittelwirkungen - Pharmakologie, Klinische Pharmakologie, Toxikologie, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart, 11. Auflage, 2020.
BRCA-Mutation
- Deutsche Krebshilfe (04/2018): Familiärer Brust- und Eierstockkrebs. Die blauen Ratgeber 24
Brustkrebsoperationen
- Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften. Interdisziplinäre S3-Leitlinie für die Früherkennung, Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Mammakarzinoms. Stand August 2019. Online unter www.leitlinienprogramm-onkologie.de (Anruf: 25.08.2023).
- Deutsche Krebsgesellschaft, Onko Internetportal, Brustkrebs: Basis-Infos für Patientinnen und Angehörige. Online unter www.krebsgesellschaft.de (Zugriff am 25.08.2023).
- AGO Empfehlungen „Diagnosis and Treatment of Patients with Primary and Metastatic Breast Cancer”, Stand: März 2021:
https://www.ago-online.de







