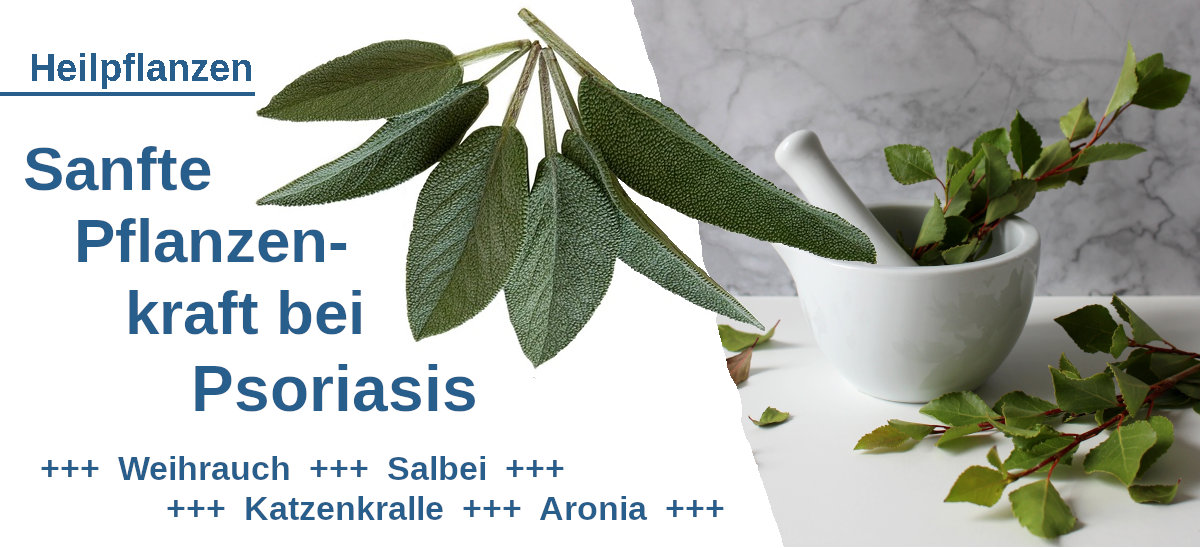Autor: Mazin Shanyoor
Psoriasis ist mehr als eine chronische Hauterkrankung – sie ist ein unsichtbarer Kampf, der weit über die Oberfläche hinausgeht. Während die schuppigen, entzündeten Hautstellen für Außenstehende nur ein optisches Merkmal sind, tragen Betroffene oft eine viel schwerere Last: die Last von Vorurteilen, Missverständnissen und sozialer Ausgrenzung.
Ein einziger Blick
Ein einziger Blick, ein flüchtiger Kommentar oder das Zurückweichen eines Fremden kann tief verletzen und zeigt, wie wenig Verständnis für diese Erkrankung in unserer Gesellschaft herrscht. Doch was steckt hinter der Stigmatisierung? Und wie können Betroffene und Gesellschaft gemeinsam den Kreislauf aus Unwissenheit und Diskriminierung durchbrechen?
Es ist an der Zeit, einen ehrlichen Blick auf die wahren Herausforderungen zu werfen – und Wege zu finden, ihnen zu begegnen.
Was ist soziale Stigmatisierung – und wie zeigt sie sich bei Psoriasis?
Soziale Stigmatisierung beschreibt den Prozess, bei dem eine Person aufgrund bestimmter äußerer Merkmale oder Eigenschaften von der Gesellschaft ausgegrenzt, abgewertet oder negativ beurteilt wird. Diese Stigmatisierung entsteht oft aus Unwissenheit, Vorurteilen oder fehlendem Verständnis und führt dazu, dass die betroffene Person nicht nur ihre Symptome, sondern auch die soziale Ablehnung bewältigen muss. Bei Psoriasis geschieht dies vor allem, weil die Erkrankung sichtbare Symptome wie rote, schuppige Flecken oder entzündete Hautstellen verursacht. Obwohl Psoriasis eine nicht ansteckende Autoimmunerkrankung ist, ziehen Außenstehende häufig falsche Schlüsse, was zu Missverständnissen und Ablehnung führt. Für die Betroffenen bedeutet dies eine doppelte Belastung: Sie kämpfen nicht nur mit den körperlichen Beschwerden der Erkrankung, sondern auch mit den sozialen Konsequenzen.
Die Stigmatisierung zeigt sich bei Psoriasis auf verschiedene Weise, die sowohl subtil als auch offen verletzend sein können:
Unangenehme Kommentare
Eine der häufigsten Formen der Stigmatisierung sind unbedachte oder direkte Kommentare. Fragen wie „Was ist das auf deiner Haut?“ oder Aussagen wie „Das sieht ja schrecklich aus!“ treffen Betroffene oft unvorbereitet und können tief verletzen. Diese Kommentare sind nicht immer absichtlich böse gemeint, doch sie spiegeln die Unwissenheit wider, mit der viele Menschen Psoriasis begegnen. Besonders schmerzhaft ist es, wenn diese Bemerkungen in der Öffentlichkeit oder im Kreis von Freunden oder Kollegen geäußert werden. Betroffene fühlen sich dadurch bloßgestellt und in ihrer Würde verletzt. Oft überlegen sie sich anschließend genau, welche Situationen sie künftig vermeiden sollten, um solchen Momenten zu entgehen.
Diskriminierung und soziale Ausgrenzung
Diskriminierung geht über bloße Kommentare hinaus und äußert sich in konkreten Handlungen. Manche Menschen meiden den Kontakt mit Personen, die sichtbare Symptome von Psoriasis haben, aus Angst vor einer vermeintlichen Ansteckung. Diese falsche Annahme kann dazu führen, dass Betroffene bei sozialen oder beruflichen Gelegenheiten ausgeschlossen oder benachteiligt werden. Zum Beispiel könnte eine Person mit Psoriasis bei einer Bewerbung aufgrund der sichtbaren Hautsymptome abgelehnt werden, obwohl die Erkrankung keinerlei Einfluss auf ihre Leistungsfähigkeit hat. Auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, sei es bei Freundschaften oder Partnerschaften, erleben Betroffene oft Zurückweisung. Solche Erlebnisse hinterlassen tiefe Spuren und verstärken das Gefühl, nicht akzeptiert zu werden.
Blicke und Gesten
Selbst ohne Worte können Blicke und Gesten eine starke Wirkung haben. Abschätzige oder neugierige Blicke, die länger auf den betroffenen Hautstellen verweilen, lassen Betroffene spüren, dass sie als „anders“ wahrgenommen werden. Ein reflexartiges Zurückweichen, zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln, signalisiert den Betroffenen, dass sie nicht willkommen sind. Diese nonverbalen Reaktionen sind oft subtiler als offene Kommentare, doch sie können ebenso verletzend sein. Sie vermitteln den Eindruck, dass die Erkrankung ein Makel ist, der die betroffene Person in den Augen anderer „minderwertig“ erscheinen lässt.
Die versteckten Formen der Stigmatisierung
Stigmatisierung zeigt sich nicht immer offen. Oft sind es versteckte, indirekte Formen, die genauso belastend sein können. Ein Beispiel ist das vermeintliche „Gutgemeinte“: Aussagen wie „Hast du schon diese Creme probiert?“ oder „Vielleicht solltest du deine Ernährung ändern“ suggerieren, dass die Betroffenen selbst für ihre Erkrankung verantwortlich sind oder nicht genug tun, um ihre Symptome zu verbessern. Solche Aussagen verstärken das Gefühl von Schuld und Scham, das viele Menschen mit Psoriasis ohnehin empfinden. Auch der Mangel an Einfühlungsvermögen in sozialen Situationen, wie das Ignorieren der Erkrankung oder das Ausweichen sensibler Themen, kann Betroffene isolieren und ihnen das Gefühl geben, nicht verstanden zu werden.
Die Auswirkungen auf die Psyche
Die ständige Konfrontation mit Stigmatisierung, sei sie verbal, nonverbal oder subtil, hat schwerwiegende Auswirkungen auf die Psyche der Betroffenen. Sie fühlen sich oft ausgeschlossen, entmenschlicht und reduziert auf ihre Symptome. Dies kann zu Schamgefühlen, einem verminderten Selbstwertgefühl und sogar zu sozialer Isolation führen. Viele Menschen mit Psoriasis ziehen sich aus Angst vor Ablehnung zurück, vermeiden soziale Kontakte oder Aktivitäten, bei denen ihre Haut sichtbar sein könnte. Dieser Rückzug verstärkt die Stigmatisierung, da er die Betroffenen in ihrer Unsichtbarkeit gefangen hält.
Die Stigmatisierung von Menschen mit Psoriasis ist ein gesellschaftliches Problem, das tief in Vorurteilen und Unwissenheit verwurzelt ist. Es braucht mehr Aufklärung, Sensibilisierung und vor allem Empathie, um diese Vorurteile abzubauen und den Betroffenen den Respekt und die Akzeptanz zu geben, die sie verdienen.
Die Ursachen von Stigmatisierung
Die soziale Stigmatisierung von Menschen mit Psoriasis hat oft tiefgreifende Ursachen, die in fehlender Aufklärung, mangelndem Verständnis und gesellschaftlichen Vorurteilen wurzeln. Häufig wird die Erkrankung auf das reduziert, was für Außenstehende sichtbar ist: rote, entzündete und schuppige Hautstellen. Doch hinter diesen Symptomen steckt eine chronische Autoimmunerkrankung, die weit mehr als nur die Haut betrifft. Das Fehlen von Wissen über Psoriasis führt nicht nur zu Missverständnissen, sondern auch zu Vorurteilen, die den Alltag der Betroffenen massiv erschweren.
„Ist das ansteckend?“ – Die Angst vor Übertragung
Eines der häufigsten und hartnäckigsten Vorurteile über Psoriasis ist die Annahme, die Erkrankung sei ansteckend. Menschen sehen die sichtbaren Symptome auf der Haut und reagieren instinktiv mit Distanz oder sogar Ablehnung. Die Angst vor einer möglichen Ansteckung führt dazu, dass Betroffene gemieden werden, sei es in sozialen, beruflichen oder alltäglichen Situationen. Besonders schwierig ist dies in Momenten, in denen Nähe und Körperkontakt gefragt sind, wie beim Händeschütteln, Umarmen oder gemeinsamen Sport. Tatsächlich ist Psoriasis jedoch keine infektiöse Erkrankung, sondern eine Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem die eigenen Hautzellen angreift. Sie ist für andere vollkommen ungefährlich. Dennoch bleibt die Angst vor einer Übertragung in den Köpfen vieler Menschen bestehen, oft aufgrund mangelnder Aufklärung.
„Du solltest dich besser pflegen.“ – Das Vorurteil mangelnder Hygiene
Ein weiteres weit verbreitetes Missverständnis ist die Annahme, dass Psoriasis auf mangelnde Hygiene zurückzuführen sei. Menschen, die die Erkrankung nicht kennen, sehen schuppige Hautstellen, Krusten oder Rötungen und ziehen den falschen Schluss, dass diese durch unzureichende Körperpflege entstehen. Diese Annahme ist nicht nur falsch, sondern für Betroffene auch besonders verletzend. Viele Menschen mit Psoriasis investieren täglich viel Zeit, Mühe und Geld in die Pflege ihrer Haut. Spezielle Cremes, Salben und medizinische Behandlungen gehören oft zur täglichen Routine, um die Symptome zu lindern und die Haut zu beruhigen. Trotzdem bleibt die Haut nicht immer makellos, was Außenstehende fälschlicherweise als Vernachlässigung interpretieren. Für die Betroffenen ist es schmerzhaft, trotz großer Anstrengungen abwertende Blicke oder Kommentare zu erhalten.
„Das ist doch nur ein kosmetisches Problem.“ – Die Reduktion auf das Äußere
Viele Menschen, die mit Psoriasis nicht vertraut sind, betrachten die Erkrankung als rein kosmetisches Problem, das lediglich das äußere Erscheinungsbild betrifft. Diese oberflächliche Sichtweise ignoriert jedoch die tiefgreifenden körperlichen und psychischen Belastungen, die Psoriasis mit sich bringt. Neben den sichtbaren Hautveränderungen leiden viele Betroffene unter starkem Juckreiz, Schmerzen und einer erhöhten Anfälligkeit für Begleiterkrankungen wie Psoriasis-Arthritis. Diese körperlichen Beschwerden können den Alltag erheblich beeinträchtigen und gehen oft mit einer emotionalen Belastung einher. Das Gefühl, ständig beobachtet oder bewertet zu werden, führt bei vielen Betroffenen zu Scham, sozialer Isolation und einem verminderten Selbstwertgefühl. Die Reduktion auf das Äußere nimmt der Erkrankung ihre Ernsthaftigkeit und verstärkt das Gefühl, nicht verstanden zu werden.
Gesellschaftliche Schönheitsideale und mediale Einflüsse
Ein weiterer Faktor, der zur Stigmatisierung beiträgt, sind gesellschaftliche Schönheitsideale. In einer Welt, die makellose Haut und äußerliche Perfektion oft als Maßstab für Attraktivität setzt, wirken sichtbare Hauterkrankungen wie Psoriasis schnell als „Makel“. Betroffene werden nicht selten auf ihre Haut reduziert und erleben eine subtile, aber spürbare Ablehnung in sozialen und beruflichen Kontexten. Hinzu kommt, dass Psoriasis in den Medien selten thematisiert wird. Wenn die Erkrankung doch zur Sprache kommt, wird sie oft verharmlost oder falsch dargestellt, was das fehlende Verständnis in der Gesellschaft weiter verstärkt.
Die Ursachen der Stigmatisierung von Menschen mit Psoriasis sind somit vielschichtig. Sie reichen von Unwissenheit über tiefsitzende gesellschaftliche Vorurteile bis hin zu fehlender Aufklärung. Diese Mechanismen führen dazu, dass Betroffene nicht nur mit den physischen Symptomen der Erkrankung kämpfen, sondern auch mit der emotionalen Belastung, die durch Ablehnung und Missverständnisse entsteht. Eine umfassende Aufklärung über Psoriasis ist daher entscheidend, um Vorurteile abzubauen und den Betroffenen den Respekt und die Unterstützung zu geben, die sie verdienen.
Die emotionalen Folgen von Stigmatisierung
Die Erfahrung, wegen Psoriasis anders behandelt zu werden, kann tiefe Spuren hinterlassen. Viele Betroffene berichten von einem verminderten Selbstwertgefühl, sozialer Isolation und sogar Depressionen. Die ständige Angst vor negativen Reaktionen führt dazu, dass sich viele zurückziehen und Aktivitäten meiden, bei denen die Haut sichtbar sein könnte. Der Gedanke, ständig beobachtet oder bewertet zu werden, kann lähmend sein und dazu führen, dass Betroffene den Kontakt zu anderen meiden.
Wie man mit Stigmatisierung umgehen kann
Obwohl die sozialen Herausforderungen durch Psoriasis real sind, gibt es Strategien und Ansätze, um damit umzugehen:
- Aufklärung und Gespräche: Eine der wirksamsten Methoden, Vorurteile abzubauen, ist die Aufklärung. Wer sich wohlfühlt, kann offen über Psoriasis sprechen und erklären, dass die Erkrankung nicht ansteckend ist. Eine einfache Erklärung wie „Das ist eine Autoimmunerkrankung, die nicht gefährlich oder ansteckend ist“ kann helfen, Missverständnisse zu klären.
- Selbstbewusstsein stärken: Der Umgang mit Stigmatisierung beginnt oft bei einem selbst. Selbstbewusstsein aufzubauen und sich selbst so zu akzeptieren, wie man ist, kann dabei helfen, negative Kommentare oder Blicke weniger schwer zu nehmen.
- Unterstützung suchen: Der Austausch mit anderen Betroffenen – sei es in Selbsthilfegruppen oder Online-Foren – kann enorm entlastend sein. Zu wissen, dass man nicht allein ist, und Erfahrungen zu teilen, stärkt das Gefühl von Gemeinschaft und Verständnis.
- Grenzen setzen: Es ist völlig in Ordnung, unangenehme Kommentare höflich, aber bestimmt abzuweisen. Sätze wie „Das ist eine chronische Erkrankung, die nicht ansteckend ist – mehr müssen Sie darüber nicht wissen“ können helfen, unangenehme Gespräche zu beenden.
- Therapeutische Hilfe: Wenn die Stigmatisierung zu großen emotionalen Belastungen führt, kann psychotherapeutische Unterstützung helfen, mit den Herausforderungen umzugehen und Selbstwertgefühl zurückzugewinnen.
Gemeinsam gegen Vorurteile: Die Gesellschaft in die Pflicht nehmen
So wichtig es ist, dass Betroffene mit ihrer Erkrankung lernen umzugehen, so sehr ist auch die Gesellschaft gefragt, mehr Verständnis und Sensibilität zu entwickeln. Bildungskampagnen, Medienberichte und gezielte Informationsarbeit können dazu beitragen, Vorurteile gegenüber Psoriasis abzubauen. Ein offener und respektvoller Umgang mit Menschen, die sichtbar anders sind, sollte für alle selbstverständlich sein.
Ein Lichtblick für Betroffene
Die Erfahrung von Stigmatisierung mag schmerzhaft sein, doch sie ist nicht das Ende der Geschichte. Viele Menschen mit Psoriasis haben Wege gefunden, trotz der Herausforderungen ein erfülltes Leben zu führen und ihre Selbstachtung zu bewahren. Jeder Schritt, der dazu beiträgt, Missverständnisse aufzuklären und Vorurteile zu entkräften, ist ein Schritt hin zu einer toleranteren und verständnisvolleren Gesellschaft.
Wenn Sie selbst von Psoriasis betroffen sind, denken Sie daran: Ihre Stärke definiert Sie, nicht Ihre Haut. Und je mehr Sie sich selbst akzeptieren, desto weniger Macht haben die Vorurteile anderer über Sie. Sie sind mehr als Ihre Psoriasis – und das verdient Respekt und Anerkennung.
Verwandte Beiträge
Meist gelesen
Bahnbrechende Charité-Studie zeigt: Niedrig dosiertes Kortison als Schlüssel zur sicheren Langzeittherapie
Autor: Mazin Shanyoor
Weniger Nebenwirkungen, mehr Sicherheit bei chronische-entzündlichen Erkrankungen
Kortison gilt seit Jahrzehnten als eines der bekanntesten und wirksamsten Medikamente zur Behandlung entzündlicher Erkrankungen. Trotz seiner beeindruckenden Wirkung wird die langfristige Anwendung von Kortison jedoch oft mit erheblichen Nebenwirkungen in Verbindung gebracht, was sowohl Patienten als auch Ärzte verunsichert. Eine aktuelle Studie der Charité – Universitätsmedizin Berlin bringt nun entscheidende neue Erkenntnisse, die dazu beitragen könnten, die Sorgen um dieses Medikament zu verringern und seine Bedeutung in der Therapie chronischer Erkrankungen zu stärken. Besonders relevant sind diese Ergebnisse für Patienten mit chronischen entzündlichen Erkrankungen wie rheumatoider Arthritis, Morbus Crohn oder Lupus erythematodes, die oft auf eine Langzeittherapie mit Kortison angewiesen sind.