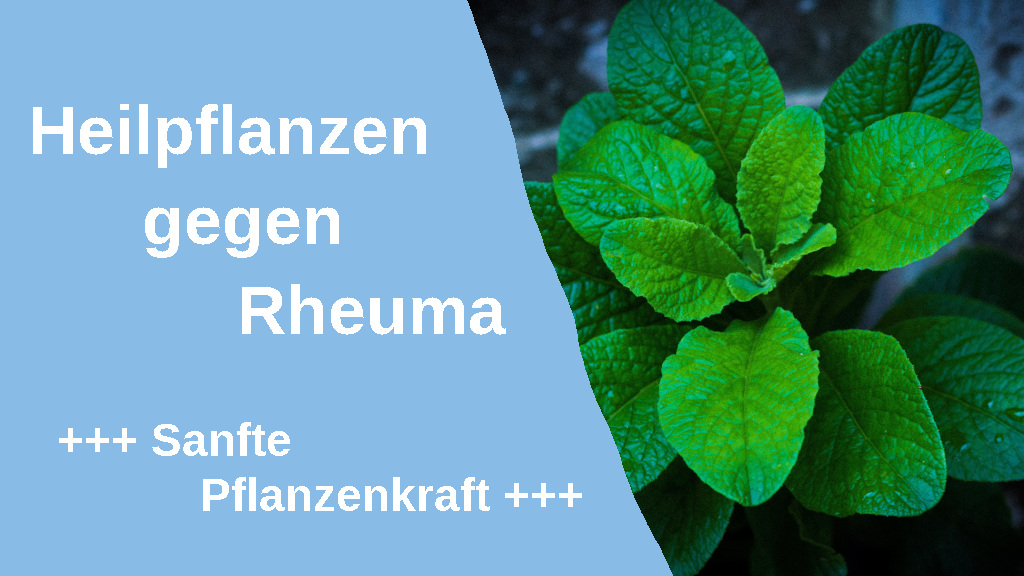Autor: Mazin Shanyoor
Das Sjögren-Syndrom ist eine chronische Autoimmunerkrankung, die vor allem die Speicheldrüsen und Tränendrüsen betrifft und zu erheblichen Beschwerden wie Mundtrockenheit und Augentrockenheit führt. Aktuell gibt es keine kurative Therapie für diese Erkrankung. Eine neue Studie hat jedoch vielversprechende Ergebnisse bei der Verwendung von JAK-STAT-Inhibitoren zur Behandlung von Sjögren-Syndrom gezeigt.
Details zur Studie
Die Studie begann im Jahr 2022 und wurde an mehreren führenden medizinischen Forschungseinrichtungen in den USA durchgeführt, darunter das National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases sowie das National Institute of Dental and Craniofacial Research. Die Ergebnisse wurden im März 2024 in den Annals of the Rheumatic Diseases veröffentlicht. Insgesamt nahmen 150 Patienten mit diagnostiziertem Sjögren-Syndrom an der Studie teil, bei der die Sicherheit und Wirksamkeit von JAK-STAT-Inhibitoren über einen Zeitraum von 12 Monaten untersucht wurden. Die Studie trägt den Titel "Inhibition of JAK-STAT pathway corrects salivary gland inflammation and interferon driven immune activation in Sjögren’s Disease".
Die Rolle des JAK-STAT-Wegs
Der JAK-STAT-Signalweg spielt eine zentrale Rolle bei der Regulation der Immunantwort. Dieser Weg wird durch Zytokine aktiviert, die an spezifische Zelloberflächenrezeptoren binden. Zu den Zytokinen gehören Interferone, Interleukine und andere Wachstumsfaktoren, die bei Entzündungsprozessen eine wichtige Rolle spielen. Sobald diese Zytokine an ihre Rezeptoren binden, rekrutieren und aktivieren sie die Januskinasen (JAKs), eine Familie von Tyrosinkinasen. Die aktivierten JAKs phosphorylieren dann die Signaltransducer und Aktivatoren der Transkription (STATs).
Die phosphorylierten STATs dimerisieren und translozieren in den Zellkern, wo sie die Transkription spezifischer Gene regulieren, die an der Immunantwort und Entzündung beteiligt sind. Diese Gene codieren für eine Vielzahl von proinflammatorischen Molekülen, einschließlich Zytokinen, Chemokinen und anderen Mediatoren, die die Entzündungsreaktion weiter verstärken.
Beim Sjögren-Syndrom ist der JAK-STAT-Signalweg überaktiviert. Dies führt zu einer ständigen Aktivierung der Immunzellen und einer chronischen Entzündung der Speicheldrüsen. Diese chronische Entzündung verursacht Gewebeschäden, die schließlich zur Dysfunktion der Drüsen führen. Patienten mit Sjögren-Syndrom leiden unter Symptomen wie starker Mund- und Augentrockenheit, die durch die unzureichende Sekretion der Speichel- und Tränendrüsen bedingt ist.
Die Studie untersuchte die Blockade dieses Signalwegs durch den Einsatz von JAK-STAT-Inhibitoren. Diese Inhibitoren zielen darauf ab, die Aktivität der JAKs zu hemmen, wodurch die Phosphorylierung und Aktivierung der STATs verhindert wird. Ohne aktivierte STATs kann die Transkription der entzündungsfördernden Gene nicht stattfinden, was zu einer Reduktion der entzündlichen Mediatoren führt.
Durch die Hemmung des JAK-STAT-Wegs wird die Entzündungsreaktion abgeschwächt, was zu einer Verringerung der Gewebeschädigung und einer Verbesserung der Drüsenfunktion führt. Dies könnte nicht nur die Symptome des Sjögren-Syndroms lindern, sondern auch das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen. Die Studie zeigte, dass die Behandlung mit JAK-STAT-Inhibitoren zu einer signifikanten Reduktion der Entzündungsmarker und einer Normalisierung der Immunaktivierung führte, was die Wirksamkeit dieser Therapieoption unterstreicht.
Auf lange Sicht könnte die Blockade des JAK-STAT-Wegs eine vielversprechende Strategie zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen wie dem Sjögren-Syndrom sein, indem sie sowohl die Symptome lindert als auch die zugrunde liegenden pathologischen Prozesse moduliert.
Studienergebnisse
Die Ergebnisse der Studie sind vielversprechend. Durch den Einsatz von JAK-STAT-Inhibitoren konnte eine signifikante Reduktion der Entzündungsmarker in den Speicheldrüsen und eine Normalisierung der Immunaktivierung beobachtet werden. Speziell zeigten die Untersuchungen an menschlichen Speicheldrüsen und peripheren Blutmononuklearzellen (PBMCs), dass der JAK-STAT-Weg in den betroffenen Geweben aktiviert ist. Mit Hilfe von RNA-Sequenzierungen und Immunfluoreszenzmikroskopie wurde nachgewiesen, dass die Expression von Interferon-stimulierten Genen (ISGs) erhöht ist und mit klinischen Variablen wie Fokuswerten und Anti-SSA-Positivität korreliert.
Ein weiterer wichtiger Befund war die Zelltypspezifität der JAK-STAT-Aktivierung. So zeigten die einzelnen Zelltypen in den Speicheldrüsen, einschließlich infiltrierender Lymphozyten, epithelialer und antigenpräsentierender Zellen sowie Endothelzellen, eine signifikante Hochregulation dieses Signalwegs. Ähnliche Trends wurden in PBMCs beobachtet, wobei besonders in Monozyten eine starke Hochregulation der ISGs festgestellt wurde.
Ex-vivo-Studien bestätigten diese Beobachtungen, indem sie zeigten, dass die basalen pSTAT-Niveaus in Sjögren-Syndrom-Proben durch die Behandlung mit JAK-STAT-Inhibitoren normalisiert werden konnten. Diese Behandlung führte zu einer Reduktion der übermäßigen Immunantwort und verhinderte gleichzeitig zytotoxische Effekte auf die Speicheldrüsenepithelzellen.
Die Studie stellt somit eine wichtige Grundlage dar, um die potenzielle Wirksamkeit von JAK-STAT-Inhibitoren in der Behandlung des Sjögren-Syndroms weiter zu untersuchen. Auf Basis dieser vielversprechenden Ergebnisse wurde bereits eine Phase Ib/IIa randomisierte kontrollierte Studie initiiert, um die Anwendung von Tofacitinib bei Sjögren-Patienten zu testen.
Medikamente und Wirkstoffe
In der Studie wurde der Wirkstoff Tofacitinib, ein JAK-STAT-Inhibitor, verwendet. Tofacitinib ist unter dem Handelsnamen Xeljanz bekannt und wird bereits zur Behandlung anderer Autoimmunerkrankungen wie rheumatoider Arthritis eingesetzt. Der Wirkstoff wirkt, indem er die JAK-STAT-Signalkaskade hemmt, wodurch die entzündliche Immunantwort reduziert wird. Tofacitinib wurde ursprünglich entwickelt, um spezifisch die Enzyme Januskinase 1 (JAK1) und Januskinase 3 (JAK3) zu hemmen, die eine wichtige Rolle bei der Signalübertragung von Zytokinen spielen, welche an Entzündungsprozessen beteiligt sind. Durch die Blockierung dieser Enzyme wird die Aktivierung von STAT-Proteinen verhindert, die für die Transkription proinflammatorischer Gene verantwortlich sind. Dadurch wird die Produktion von Entzündungsmediatoren verringert und die entzündliche Reaktion abgeschwächt.
Tofacitinib wird oral verabreicht und in der Regel in einer Dosierung von 5 mg zweimal täglich eingenommen. Bei Bedarf kann die Dosis angepasst werden, um die gewünschte therapeutische Wirkung zu erzielen. Die Behandlung mit Tofacitinib erfordert eine regelmäßige Überwachung der Patienten, um die Wirksamkeit und Sicherheit der Therapie sicherzustellen.
Wirkmechanismus von Tofacitinib
Tofacitinib wirkt als Inhibitor der Januskinasen (JAKs), die entscheidende Enzyme im JAK-STAT-Signalweg sind. Dieser Signalweg wird durch Zytokine aktiviert, die an Zelloberflächenrezeptoren binden und JAKs rekrutieren. Diese Enzyme phosphorylieren dann Signaltransducer und Aktivatoren der Transkription (STATs), die in den Zellkern translozieren und dort die Expression entzündungsfördernder Gene regulieren.
Durch die Hemmung von JAKs unterbricht Tofacitinib diesen Signalweg. Konkret bindet Tofacitinib an die JAKs und verhindert deren Aktivierung und nachfolgende Phosphorylierung von STATs. Dies führt zu einer Reduktion der Produktion von proinflammatorischen Zytokinen, die für die Aufrechterhaltung der Entzündungsreaktion verantwortlich sind. Infolgedessen wird die chronische Entzündungsreaktion, die typisch für Autoimmunerkrankungen wie das Sjögren-Syndrom ist, gemindert. Dieser Mechanismus trägt dazu bei, die Symptome zu lindern und die Funktion der betroffenen Drüsen zu verbessern.
In der aktuellen Studie zeigte sich, dass durch die Behandlung mit Tofacitinib nicht nur die Entzündungsmarker reduziert wurden, sondern auch eine signifikante Verbesserung der klinischen Symptome erreicht werden konnte. Die Patienten berichteten über eine Verminderung der Mund- und Augentrockenheit sowie eine Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens.
Nebenwirkungen von Tofacitinib
Wie bei vielen Medikamenten können auch bei der Anwendung von Tofacitinib Nebenwirkungen auftreten. Zu den häufigsten Nebenwirkungen zählen Infektionen der oberen Atemwege, Kopfschmerzen, Durchfall und Nasopharyngitis. Diese Nebenwirkungen sind meist mild und vorübergehend. Schwerwiegendere Nebenwirkungen können jedoch ebenfalls auftreten und erfordern eine engmaschige Überwachung durch den behandelnden Arzt.
Ein erhöhtes Risiko für schwere Infektionen, einschließlich Tuberkulose und Herpes Zoster (Gürtelrose), wurde beobachtet. Diese Infektionen können schwerwiegend sein und eine sofortige medizinische Behandlung erfordern. Zusätzlich wurde in einigen Fällen eine Erhöhung des Risikos für Thrombosen (Blutgerinnsel) festgestellt, die zu tiefen Venenthrombosen oder Lungenembolien führen können.
Es besteht auch ein geringes Risiko für die Entwicklung von Neoplasien (Tumoren), insbesondere von Lymphomen und anderen malignen Erkrankungen. Regelmäßige Kontrollen und Vorsorgeuntersuchungen sind daher wichtig, um frühzeitig mögliche Anzeichen einer Tumorentwicklung zu erkennen.
Zu den seltenen, aber potenziell schwerwiegenden Nebenwirkungen gehören Leberschäden, die sich in erhöhten Leberenzymwerten äußern können. Patienten sollten daher regelmäßig ihre Leberwerte überprüfen lassen. Eine Verringerung der weißen Blutkörperchen (Leukozyten) und roten Blutkörperchen (Erythrozyten) kann ebenfalls auftreten, was zu einem erhöhten Infektionsrisiko und Anämie führen kann.
Wegen dieser möglichen Nebenwirkungen ist es essenziell, dass Patienten, die Tofacitinib einnehmen, regelmäßig von ihrem Arzt überwacht werden. Dies umfasst Blutuntersuchungen zur Überprüfung der Blutzellzahlen und der Leberfunktion sowie regelmäßige Kontrollen auf Anzeichen von Infektionen oder anderen Komplikationen.
Fazit
Die Studie zeigt, dass JAK-STAT-Inhibitoren eine vielversprechende neue Behandlungsoption für das Sjögren-Syndrom darstellen könnten. Durch die gezielte Hemmung des überaktiven JAK-STAT-Signalwegs könnte eine Verbesserung der Symptome und eine Verringerung der chronischen Entzündung erreicht werden. Weitere klinische Studien sind notwendig, um diese Ergebnisse zu bestätigen und die Sicherheit und Wirksamkeit dieser Therapie langfristig zu beurteilen.
Quelle
- Gupta S, Yamada E, Nakamura H, et al. Inhibition of JAK-STAT pathway corrects salivary gland inflammation and interferon driven immune activation in Sjögren’s Disease. Annals of the Rheumatic Diseases. 2024.
Verwandte Beiträge
++++ Die Scham der eigenen Schwäche ++++
Fatigue bei rheumatischen Erkrankungen: Die unsichtbare Last der ständigen Erschöpfung
Rheumatische Erkrankungen sind weit verbreitet und umfassen eine Vielzahl von chronischen Beschwerden, die das Immunsystem, die Gelenke und das Bindegewebe betreffen. Eine der weniger sichtbaren, aber äußerst belastenden Folgen dieser Krankheiten ist die Fatigue – eine ständige und tiefe Erschöpfung, die weit über normale Müdigkeit hinausgeht. Für viele Betroffene ist diese Müdigkeit eine der größten Herausforderungen im Alltag, da sie Körper und Geist gleichermaßen betrifft.
Meist gelesen
Bahnbrechende Charité-Studie zeigt: Niedrig dosiertes Kortison als Schlüssel zur sicheren Langzeittherapie
Autor: Mazin Shanyoor
Weniger Nebenwirkungen, mehr Sicherheit bei chronische-entzündlichen Erkrankungen
Kortison gilt seit Jahrzehnten als eines der bekanntesten und wirksamsten Medikamente zur Behandlung entzündlicher Erkrankungen. Trotz seiner beeindruckenden Wirkung wird die langfristige Anwendung von Kortison jedoch oft mit erheblichen Nebenwirkungen in Verbindung gebracht, was sowohl Patienten als auch Ärzte verunsichert. Eine aktuelle Studie der Charité – Universitätsmedizin Berlin bringt nun entscheidende neue Erkenntnisse, die dazu beitragen könnten, die Sorgen um dieses Medikament zu verringern und seine Bedeutung in der Therapie chronischer Erkrankungen zu stärken. Besonders relevant sind diese Ergebnisse für Patienten mit chronischen entzündlichen Erkrankungen wie rheumatoider Arthritis, Morbus Crohn oder Lupus erythematodes, die oft auf eine Langzeittherapie mit Kortison angewiesen sind.